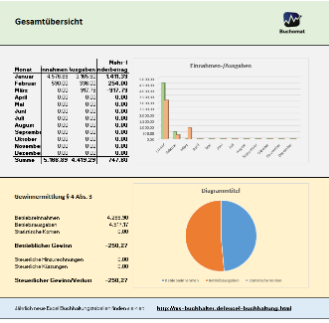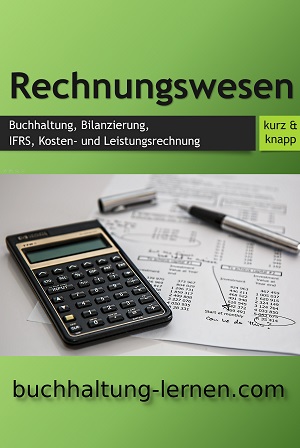Selbstständige in der Rentenversicherung
Wer als Selbständiger pflichtversichert ist
Inhaltsverzeichnis:
Selbstständige in der Rentenversicherung
- ..
- 8.1 Waisenrente
- 8.2 Witwen- und Witwerrenten
- 8.3 Rentensplitting
- ..
- ⤺ Zurück zum Inhaltsverzeichnis Selbständige in der Rentenversicherung
8.2 Witwen- und Witwerrenten Bei den Rentenansprüchen, die Witwen oder Witwer nach dem Tod des versicherten Ehegatten haben, wird zwischen kleiner und großer Witwen- bzw. Witwerrente unterschieden. Beide Renten dienen dem Zweck, durch den Tod des Versicherten weggefallene Unterhaltsansprüche des hinterbliebenen Ehegatten zu ersetzen. Die kleine Witwen- bzw. Witwerrente beträgt 25 % und die große Witwen- bzw. Witwerrente 55 % der Altersrente des Versicherten. Der Grund für die unterschiedliche Höhe der Rente liegt darin, dass die hinterbliebenen Ehegatten, die wegen Erwerbsminderung, wegen ihres höheren Lebensalters oder wegen Kindererziehung eine Erwerbstätigkeit nicht oder nur in geringem Maße ausüben können, stärker auf die Absicherung durch die Hinterbliebenenrente angewiesen sind als Witwen und Witwer, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der versicherte Ehegatte verstorben ist, dem sog. Sterbevierteljahr, steht dem hinterbliebenen Ehegattenallerdingseine Rente in Höhe der vollen Versichertenrente des Verstorbenen zu. Voraussetzung für den Bezug einer kleinen Witwen- bzw. Witwerrente ist neben der Erfüllung der allgemeinen Wartezeit durch den versicherten Ehegatten zunächst einmal, dass nach dessen Tod der hinterbliebene Ehegatte nicht wieder geheiratet hat (§ 46 Abs. 1 SGB VI). Witwe bzw. Witwer ist die Person, die zum Zeitpunkt des Todes der versicherten Person mit dieser in einer rechtsgültigen Ehe verheiratet war. Seit dem 1.1.2005 können aber auch Hinterbliebene einer eingetragenen Lebenspartnerschaft (i.S. des Lebenspartnerschaftsgesetzes v. 16.2.2001) grundsätzlich einen Anspruch auf Witwen- und Witwerrente (eventuell auch nach dem vorletzten Lebenspartner) erlangen. Für Lebenspartner einer - nicht ehelichen bzw. nicht eingetragenen - „eheähnlichen\" Lebensgemeinschaft besteht allerdings nach wie vor kein Anspruch auf Witwen- bzw. Witwerrente in der gesetzlichen RV. Da die eingetragene Lebenspartnerschaft der Ehe insoweit gleichgestellt ist (§ 46 Abs.4 SGB VI), gelten für diesen Personenkreis auch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen für eine Witwen- bzw. Witwerrente. Bereits zum 1.1.2002 sind insbesondere auch im Hinblick auf die kleine Witwen bzw. Witwerrente umfassende rechtliche Neuregelungen in Kraft getreten. Danach besteht in den Fällen, in denen der versicherte Ehegatte nach dem 31.12.2001 verstorben ist, der Anspruch auf die kleine Witwen bzw. Witwerrente grundsätzlich längstens für 24 Kalendermonate nach Ablauf des Monats, in dem der Versicherte verstorben ist. Ist der versicherte Ehegatte also bereits vor dem 1.1.2002 verstorben, wird die kleine Witwen- bzw. Witwerrente ohne die Beschränkung auf 24 Kalendermonate geleistet. Verstirbt der versicherte Ehegatte nach dem 31.12.2001, besteht ein Anspruch auf die kleine Witwen- bzw. Witwerrente außerdem auch dann ohne Beschränkung auf 24 Kalendermonate, wenn die Ehe vor dem 1.1.2002 geschlossen worden ist, sofern zusätzlich mindestens einer der Ehegatten vor dem 2.1.1962 geboren ist. Um eine große Witwen- bzw. Witwerrente erhalten zu können, muss der hinterbliebene Ehegatte zusätzlich zu den für die kleine Witwen- bzw. Witwerrente erforderlichen Voraussetzungen entweder das 45. Lebensjahr vollendet haben (gilt nur noch für Todesfälle vor dem 1.1.2012; bei Todesfällen in der Zeit von 2012 bis 2029 wird die Altersgrenze stufen weise vom 45. auf das 47. Lebensjahr heraufgesetzt) oder erwerbsgemindert sein oder aber ein eigenes Kind oder ein Kind des versicherten Ehegatten, welches das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, erziehen (§§ 46 Abs. 2, 242a Abs. 4 und 5 SGB VI). Da bei den eigenen Kindern der Witwe bzw. des Witwers keine rechtliche Beziehung zu dem verstorbenen Versicherten bestehen muss, spielt es keine Rolle, wenn das Kind erst nach dem Tod des Versichertengeboren wurde. Als Kinder werden neben den leiblichen und adoptierten Kindern ebenfalls Stief und Pflegekinder berücksichtigt, die in den Haushalt der Witwe oder des Witwers aufgenommen sind. Gleiches gilt für Enkel und Geschwister, die in den Haushalt der Witwe oder des Witwers aufgenommen sind oder von diesen überwiegend unterhalten werden. Der Anspruch auf die große Witwen- bzw. Witwerrente besteht, wenn eine Witwe bzw. ein Witwer in häuslicher Gemeinschaft die Sorge für ein Kind ausübt, das sich wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht selbst unterhalten kann, ohne Altersbegrenzung (also auch über das 18. Lebensjahr des Kindes hinaus). Ist das behinderte Kind jedoch in einem Heim untergebracht, sorgt der hinterbliebene Ehegatte auch dann nicht für dieses Kind, wenn er die Kosten der Unterbringung zum Teil oder ganz trägt. Einen Anspruch auf große Witwen- bzw. Witwerrente haben nach § 242a Abs. 2 SGB VI bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen auch die Witwen bzw. Witwer, die vor dem 2.1.1961 geboren und berufsunfähig i.S.v. § 240 Abs. 2 SGB VI sind (vgl. hierzu auch Ziff. 4.5) oder die am 31.12.2000 bereits berufs- oder erwerbsunfähig waren und dies ununterbrochen sind (vgl. hierzu auch Ziff. 4.7). Für Witwen bzw. Witwer, die bereits am 31.12.2000 Anspruch auf eine große Witwen- bzw. Witwerrente wegen BU oder EU hatten, besteht dieser Anspruch weiter, solange die für die Bewilligung der Leistung maß geblichen Voraussetzungen weiterhin vorliegen. Ist die Rente in diesen Fällen befristet worden, gilt diese Regelung auch für einen Anspruch nach Ablauf der Frist (§ 303a SGB VI). Der Anspruch auf eine kleine oder große Witwen- bzw. Witwerrente wird- ähnlich wie dies z.B. im Bereich der Unfallversicherung gehandhabt wird - vom 1.1.2002 an völlig ausgeschlossen, wenn die Ehe mit dem verstorbenen Ehegatten weniger als ein Jahr gedauert hat und der alleinige oder überwiegende Zweck der Heirat war, den Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente zu begründen, also eine sog. „Versorgungsehe\" vorliegt (§ 46 Abs. 2a SGB VI). Diese Regelung gilt jedoch nicht für die Fälle, in denen die Ehe bereits vor dem 1.1.2002 geschlossen wurde (§ 242a Abs. 3 SGBVI). Ein Anspruch auf die kleine oder große Witwen- bzw. Witwerrente besteht auch nicht (mehr) mit Ablauf des Monats, in dem die Bestandskraft der Entscheidung des Rentenversicherungsträgers über das Rentensplitting eintritt (§ 46 Abs. 2b SGB VI; zum Rentensplitting s. Ziff. 8.3). Hat ein Ehegatte, nachdem die Ehe mit dem Versicherten durch dessen Tod aufgelöst worden ist, erneut geheiratet, liegen aber sämtliche anderen Anspruchsvoraussetzungen für eine kleine oder große Witwen- bzw. Witwerrente vor, kann er die kleine oder große Witwen- bzw. Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten erhalten (§ 46 Abs. 3 SGB VI). Dazu muss die erneute Ehe für nichtig erklärt oder durch Scheidung, Aufhebung oder Tod des neuen Ehegatten aufgelöst worden sein. Es kommt hier nicht darauf an, wie bei der „Wiederauflebensrente\" nach dem bis zum 31.12.1991 geltenden Recht, dass ein Anspruch auf Witwen- bzw. Witwerrente bereits bestanden hat, der durch die Wiederheirat später weggefallen ist. Allerdings besteht der Anspruch nur nach einer weiteren Ehe, nicht nach zwei oder mehr erneuten Eheschließungen. Hat der Berechtigte neben dem Rentenanspruch nach dem vorletzten Ehegatten für denselben Zeitraum auch einen Witwen- bzw. Witwerrentenanspruch aus der Versicherung seines nachfolgenden Ehe gatten, wird dieser Anspruch ebenso wie Ansprüche auf Versorgung, Unterhalt oder auf sonstige Renten auf seine Witwen- bzw. Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten angerechnet. Geschiedene Ehegatten, deren Ehe mit dem Versicherten vor dem 1.7.1977 und damit vor der Einführung des Versorgungsausgleichs geschieden worden ist, können ebenfalls einen Anspruch auf kleine oder große Witwen- bzw. Witwerrente haben (§ 243 SGB VI). Die Leistung der kleinen Witwen- bzw. Witwerrente ist hier nicht auf 24 Kalendermonate beschränkt. Ehegatten, deren Ehe mit dem Versicherten vor diesem Zeitpunkt für nichtig erklärt oder aufgehoben wurde, stehen den geschiedenen Ehegatten gleich. Seit dem 1.7.1977 gewährleistet der Versorgungsausgleich an Stelle dieser Hinterbliebenenrente die eigenständige soziale Sicherung des geschiedenen Ehegatten. Hat ein geschiedener Ehegatte zu Lebzeiten des Versicherten wieder geheiratet, besteht allerdings kein Anspruch auf die Hinterbliebenenrente mehr. Das gilt ebenso für die Witwen bzw. Witwerrente an vor dem 1.7.1977 geschiedene Ehegatten nach dem vorletzten Ehegatten (§ 243 Abs.4 SGB VI). Auch hier muss die erneute Ehe nach dem Tod des Versicherten geschlossen worden sein. Der Grund dafür liegt darin, dass mit der Wiederheirat die Notwendigkeit entfällt, einen mit dem Tod des Versicherten weggefallenen Unterhaltsanspruch zu ersetzen. Dementsprechend ist auch eine der wesentlichen Voraussetzungen bei der Witwen- bzw. Witwerrente an vor dem 1.7.1977 geschiedene Ehegatten, dass der den Rentenanspruch geltend machende Ehegatte im letzten Jahr vor dem Tod des Versicherten entweder tatsächlich Unterhalt von diesem erhalten hat oder zumindest vor dem Tod des Versicherten einen Unterhaltsanspruch gegen ihn gehabt hat. Außerdem muss der Versicherte nach dem 30.4.1942 gestorben sein. Bestimmt sich allerdings der Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehe gatten nach dem Recht, das im Beitrittsgebiet gegolten hat, besteht kein Anspruch auf eine Witwen- bzw. Witwerrente an vor dem 1.7.1977 geschiedene Ehegatten (§ 243a SGB VI). In diesen Fällen kann aber der Anspruch auf eine Erziehungsrente auch dann gegeben sein, wenn die Ehe vor dem 1.7.1977 geschieden worden ist, sofern die übrigen Voraussetzungen für diese Rente erfüllt werden (vgl. dazu Ziff.5).
Rechtsgrundlagen zum Thema: Rentenversicherung
EStGEStG § 3
EStG § 4d Zuwendungen an Unterstützungskassen
EStG § 8 Einnahmen
EStG § 10
EStG § 10a Zusätzliche Altersvorsorge
EStG § 20
EStG § 22 Arten der sonstigen Einkünfte
EStG § 22a Rentenbezugsmitteilungen an die zentrale Stelle
EStG § 38 Erhebung der Lohnsteuer
EStG § 39b Einbehaltung der Lohnsteuer
EStG § 40a Pauschalierung der Lohnsteuer für Teilzeitbeschäftigte und geringfügig Beschäftigte
EStG § 41b Abschluss des Lohnsteuerabzugs
EStG § 42f Lohnsteuer-Außenprüfung
EStG § 49 Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte
EStG § 65 Andere Leistungen für Kinder
EStG § 81 Zentrale Stelle
EStG § 81a Zuständige Stelle
EStG § 86 Mindesteigenbeitrag
EStG § 90 Verfahren
EStG § 91 Datenerhebung und Datenabgleich
EStG § 93 Schädliche Verwendung
EStG § 99 Ermächtigung
EStR
EStR R 4b. Direktversicherung
EStR R 4d. Zuwendungen an Unterstützungskassen
EStR R 6a. (Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen
EStR R 16. Veräußerung des gewerblichen Betriebs
EStR R 22.4 Besteuerung von Leibrenten i. S. d. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG
EStR R 32b. Progressionsvorbehalt
EStR R 33a.1 Aufwendungen für den Unterhalt und eine etwaige Berufsausbildung
EStR R 33b. Pauschbeträge für behinderte Menschen, Hinterbliebene und Pflegepersonen
GewStG
GewStG § 3 Befreiungen
KStG 5
AO
AO § 6 Behörden, Finanzbehörden
AO § 6 Behörden, Finanzbehörden
UStAE
UStAE 4.27.2. Gestellung von land- und forstwirtschaftlichen Arbeitskräften sowie Gestellung von Betriebshelfern
UStAE 4.27.2. Gestellung von land- und forstwirtschaftlichen Arbeitskräften sowie Gestellung von Betriebshelfern
UStR
UStR 121a. Gestellung von land- und forstwirtschaftlichen Arbeitskräften sowie Gestellung von Betriebshelfern und Haushaltshilfen
AEAO
AEAO Zu § 31 Mitteilung von Besteuerungsgrundlagen:
AEAO Zu § 31a Mitteilungen zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und des Leistungsmissbrauchs:
ErbStR 3.5 3.6 5.1 17
ErbStDV muster-2
LStR
R 3.28 LStR Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz (AltTZG)
R 3.62 LStR Zukunftssicherungsleistungen
R 39b.8 LStR Permanenter Lohnsteuer-Jahresausgleich
R 40a.2 LStR Geringfügig entlohnte Beschäftigte
R 40b.1 LStR Pauschalierung der Lohnsteuer bei Beiträgen zu Direktversicherungen und Zuwendungen an Pensionskassen für Versorgungszusagen, die vor dem 1.1.2005 erteilt wurden
R 41a.1 LStR Lohnsteuer-Anmeldung
BewG 12
EStH 4.8 4d.4 6a.14 10.4 10.5 22.3 22.4 32.7 32.9 33.1.33.4 33a.1 33a.3 33b
LStH 3.11 3.62 8.1.1.4 19.1 19.3 39b.6 40.1
BGB 594c 1587
 Steuer-Newsletter
Steuer-Newsletter