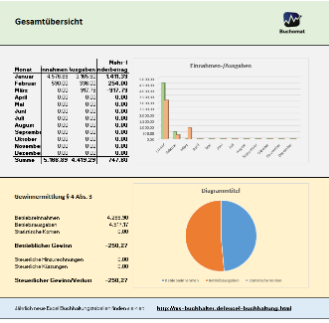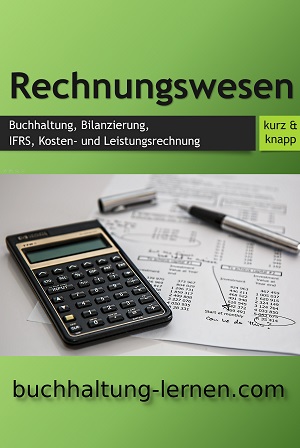Offenlegung nach HGB 2024 - 2026: Pflichten & Schwellenwerte
Die Offenlegung des Jahresabschlusses gemäß §§ 325 ff. HGB ist eine gesetzliche Pflicht für Kapitalgesellschaften und haftungsbeschränkte Personengesellschaften. Durch die Anhebung der Schwellenwerte im Jahr 2024 profitieren viele Unternehmen von Erleichterungen, müssen jedoch strikte elektronische Übermittlungsformate und Identifikationspflichten beachten.
Gesetzliche Vorschriften und Schwellenwerte
Die Pflicht zur Offenlegung richtet sich nach der Rechtsform und der Unternehmensgröße gemäß § 267 HGB (Größenklassen). Im Jahr 2024 wurden die Schwellenwerte für Bilanzsumme und Umsatzerlöse um ca. 25 % angehoben, um die Inflation auszugleichen.
Interaktiver Offenlegungs-Check
Geben Sie die Werte Ihres festgestellten Jahresabschlusses ein:
Grundlagen der Größenklassen nach HGB
Die Einstufung eines Unternehmens erfolgt nach dem Zwei-Merkmale-Prinzip. Gemäß § 267 HGB (Größenklassen) müssen mindestens zwei der drei Grenzwerte (Bilanzsumme, Umsatzerlöse, Arbeitnehmer) an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen überschritten werden, damit eine Umstufung in die höhere Klasse erfolgt.
Für das Jahr 2026 sind die durch die delegierte Richtlinie der EU angepassten Werte maßgeblich, die eine inflationsbedingte Erhöhung der monetären Schwellenwerte um rund 25 % vorsehen. Dies führt dazu, dass viele mittelständische Betriebe nun als "klein" gelten und somit von der Veröffentlichung ihrer Gewinn- und Verlustrechnung befreit sind.
| Merkmal (Schwellenwerte ab 2024) | Kleinst (§ 267a) | Klein (§ 267) | Mittelgroß (§ 267) | Groß (§ 267) |
|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | ≤ 450.000 € | ≤ 6.000.000 € | ≤ 25.000.000 € | > 25.000.000 € |
| Umsatzerlöse | ≤ 900.000 € | ≤ 12.000.000 € | ≤ 50.000.000 € | > 50.000.000 € |
| Arbeitnehmer | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 250 | > 250 |
Hinweis: Für die Einordnung müssen mindestens zwei der drei Merkmale an zwei aufeinanderfolgenden Abschlussstichtagen unter- bzw. überschritten werden.
Download der aktuellen Richtlinien
Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) & Unternehmensregister
Seit dem 1. August 2022 müssen Unterlagen für Geschäftsjahre mit Beginn nach dem 31.12.2021 direkt an das Unternehmensregister übermittelt werden. Die Einreichung erfolgt nicht mehr beim Bundesanzeiger, sondern über die Plattform des Unternehmensregisters, was eine einmalige elektronische Identitätsprüfung des Übermittlers erfordert.
Wichtige technische Neuerungen:
- Identifikationspflicht: Jede natürliche Person, die Daten übermittelt, muss sich einmalig identifizieren (z. B. via VideoIdent oder eID).
- Strukturierte Daten: Die Förderung von XML- und XBRL-Formaten wurde verstärkt, um die automatisierte Verarbeitung zu erleichtern.
Offenlegungsformen: Veröffentlichung oder Hinterlegung
Unternehmen haben je nach Größe unterschiedliche Möglichkeiten, ihren Publizitätspflichten nachzukommen. Während die Veröffentlichung die Daten für jeden kostenfrei einsehbar macht, bietet die Hinterlegung für Kleinstkapitalgesellschaften einen höheren Datenschutz.
- Veröffentlichung (§ 325 HGB): Standard für kleine, mittelgroße und große Gesellschaften. Die Bilanz (ggf. verkürzt) ist öffentlich im Unternehmensregister suchbar.
- Hinterlegung (§ 326 Abs. 2 HGB): Privileg für Kleinstkapitalgesellschaften. Die Bilanz wird digital hinterlegt, ist aber nicht öffentlich einsehbar. Dritte müssen einen kostenpflichtigen Antrag auf Einsicht stellen.
Frist: Die Offenlegung muss spätestens 12 Monate nach dem Abschlussstichtag erfolgen. Für kapitalmarktorientierte Unternehmen verkürzt sich diese Frist auf 4 Monate.
Sanktionen bei Verstößen (§ 335 HGB)
Das Bundesamt für Justiz (BfJ) leitet bei Fristüberschreitung automatisch ein Ordnungsgeldverfahren ein. Die angedrohten Beträge liegen zwischen 2.500 € und 25.000 € pro Verstoß und Organmitglied.
Bereits die Einleitung des Verfahrens löst eine Gebühr von 103,50 € aus. Erfolgt die Offenlegung innerhalb der sechswöchigen Nachfrist, kann das Ordnungsgeld herabgesetzt werden (z. B. auf 500 € bei Kleinstgesellschaften).
Rechtsgrundlagen zum Thema: Offenlegung
UStAEUStAE 13c.1. Haftung bei Abtretung, Verpfändung oder Pfändung von Forderungen
UStAE 13c.1. Haftung bei Abtretung, Verpfändung oder Pfändung von Forderungen
UStR
UStR 182b. Haftung bei Abtretung, Verpfändung oder Pfändung von Forderungen
AEAO
AEAO Zu § 162 Schätzung von Besteuerungsgrundlagen:
AEAO Zu § 173a Schreib- oder Rechenfehler bei Erstellung einer Steuererklärung:
HGB
§ 11 HGB Offenlegung in der Amtssprache eines Mitgliedstaats der Europäischen Union
§ 264 HGB Pflicht zur Aufstellung; Befreiung
§ 285 HGB Sonstige Pflichtangaben
§ 289a HGB Erklärung zur Unternehmensführung
§ 313 HGB Erläuterung der Konzernbilanz und der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung. Angaben zum Beteiligungsbesitz
§ 314 HGB Sonstige Pflichtangaben
§ 321a HGB Offenlegung des Prüfungsberichts in besonderen Fällen
§ 325 HGB Offenlegung
§ 325a HGB Zweigniederlassungen von Kapitalgesellschaften mit Sitz im Ausland
§ 326 HGB Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften und Kleinstkapitalgesellschaften bei der Offenlegung
§ 327 HGB Größenabhängige Erleichterungen für mittelgroße Kapitalgesellschaften bei der Offenlegung
§ 328 HGB Form und Inhalt der Unterlagen bei der Offenlegung, Veröffentlichung und Vervielfältigung
§ 330 HGB Formvorschriften
§ 335 HGB Festsetzung von Ordnungsgeld
§ 339 HGB Offenlegung
§ 340l HGB Offenlegungsvorschriften
§ 340o HGB Festsetzung von Ordnungsgeld
§ 341l HGB
§ 341o HGB Festsetzung von Ordnungsgeld
§ 341s HGB Pflicht zur Erstellung des Zahlungsberichts; Befreiungen
§ 341t HGB Inhalt des Zahlungsberichts
§ 341u HGB Gliederung des Zahlungsberichts
§ 341v HGB Konzernzahlungsbericht; Befreiung
§ 341w HGB Offenlegung
§ 341y HGB Ordnungsgeldvorschriften
EStH 25
BGB 312

 Steuer-Newsletter.
Steuer-Newsletter.