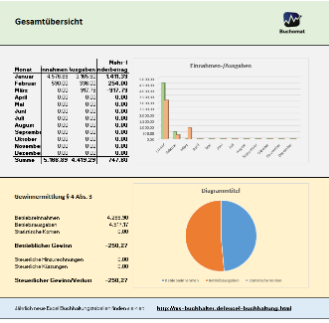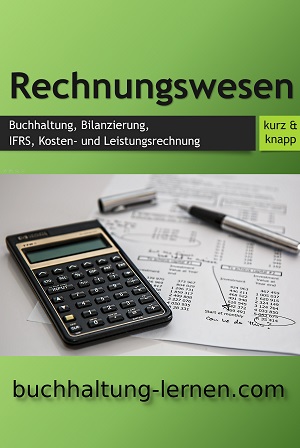Steuerfahndung (§ 208 AO) - Rechte, Pflichten + Tipps
Wann kommt die Steuerfahndung? Was durchsucht die Steuerfahndung? Was tun wenn die Steuerfahndung vor der Tür steht? Infos+ Tipps vom Steuerberater
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Wann kommt es zur Steuerfahndung?

Die Steuerfahndung ist eine besondere Einheit der Finanzverwaltung, die sich mit der Aufdeckung und Verfolgung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten befasst. Die Steuerfahndung kann bei Verdacht auf eine solche Tat eine Außenprüfung durchführen, die auch als Steuerfahndungsprüfung bezeichnet wird.
Die Steuerfahndung kommt in der Regel nur dann zum Einsatz, wenn es konkrete Anhaltspunkte für eine Steuerstraftat gibt. Diese können zum Beispiel aus einer Selbstanzeige, einer Betriebsprüfung, einer Anzeige von Dritten oder aus Datenleaks stammen. Die Steuerfahndung kann sowohl natürliche als auch juristische Personen betreffen.
Die Steuerfahndung kann in verschiedenen Situationen tätig werden:
-
Bei Verdacht auf Steuerhinterziehung: Wenn der Verdacht besteht, dass eine Person oder ein Unternehmen Steuern hinterzieht, kann die Steuerfahndung eingeschaltet werden.
-
Bei Verdacht auf Geldwäsche: Wenn der Verdacht besteht, dass durch Steuerhinterziehung erwirtschaftete Gelder gewaschen werden, kann die Steuerfahndung ebenfalls tätig werden.
-
Bei Betriebsprüfungen: Im Rahmen von Betriebsprüfungen können Unregelmäßigkeiten oder Verstöße gegen Steuervorschriften festgestellt werden, die dann von der Steuerfahndung weiterverfolgt werden können.
-
Im Rahmen von Ermittlungen: Wenn die Strafverfolgungsbehörden Ermittlungen wegen Steuerhinterziehung oder Steuerbetrug durchführen, kann die Steuerfahndung zur Unterstützung hinzugezogen werden.
Die Steuerfahndung kann verschiedene Mittel einsetzen, um ihre Ermittlungen durchzuführen. Dazu gehören unter anderem die Durchsuchung von Geschäfts- oder Privaträumen, die Beschlagnahmung von Unterlagen oder die Befragung von Zeugen.
Die Steuerfahndungsprüfung kann für den Steuerpflichtigen erhebliche Folgen haben. Neben der Nachzahlung von Steuern und Zinsen kann er auch mit einem Straf- oder Bußgeldverfahren rechnen. Eine Steuerstraftat kann nicht nur zu hohen Nachzahlungen und Zinsen führen, sondern auch zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe. Außerdem kann die Steuerfahndung seine steuerlichen Verhältnisse an andere Behörden weiterleiten, wie zum Beispiel das Finanzamt, das Gewerbeamt oder das Sozialamt. Die Steuerfahndungsprüfung kann daher sowohl finanzielle als auch rechtliche und persönliche Konsequenzen für den Steuerpflichtigen haben.
Die Steuerfahndung ist für die Betroffenen oft eine belastende Situation, die mit hohen Risiken verbunden ist. Daher ist es ratsam, sich bei einer Steuerfahndung professionell beraten und vertreten zu lassen. Ein erfahrener Steuerberater oder Rechtsanwalt kann die Rechte und Pflichten der Betroffenen wahren und eine optimale Verteidigungsstrategie entwickeln.
Aufgabe der Steuerfahndung
Die Steuerfahndung ist eine spezialisierte Abteilung der Finanzbehörden, die für die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuerbetrug zuständig ist.
Die Steuerfahndung hat gem. § 208 AO die Aufgabe,
Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten zu erforschen (§ 208 Abs. 1 Nr. 1 AO)
Besteuerungsgrundlagen in diesen Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten zu ermitteln (§ 208 Abs. 1 Nr. 2 AO) und
unbekannte Steuerfälle aufzudecken und zu ermitteln (§ 208 Abs. 1 Nr. 3 AO).
Die Steuerfahnder sind Beamte der Finanzverwaltung, die über besondere Befugnisse und Ermittlungsmethoden verfügen. Sie können zum Beispiel unangemeldet Geschäftsräume oder Wohnungen durchsuchen, Unterlagen beschlagnahmen oder Zeugen befragen.
Der Steuerfahndung kommt somit eine Doppelfunktion zu. Sie ist mit den straf- und bußgeldrechtlichen Ermittlungen zur Erforschung von Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten Justizbehörde auf der einen Seite und mit der Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen in diesen Fällen Steuerbehörde.
1. Der Steuerfahndung weist das Gesetz folgende Aufgaben zu:
a) Vorfeldermittlungen zur Verhinderung von Steuerverkürzungen (§ 85 Satz 2), die auf die Aufdeckung und Ermittlung unbekannter Steuerfälle gerichtet sind (§ 208 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3);
b) die Verfolgung bekannt gewordener Steuerstraftaten gemäß § 386 Abs. 1 Satz 1 und Steuerordnungswidrigkeiten einschließlich der Ermittlung des steuerlich erheblichen Sachverhalts und dessen rechtlicher Würdigung (§ 208 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2). § 208 Abs. 1 Sätze 2 und 3 bestimmen, welche Vorschriften für das Verfahren zur Durchführung von Steuerfahndungsmaßnahmen maßgebend sind.
Ferner kann die Steuerfahndung nach § 208 Abs. 2 Nr. 1 AO mit steuerlichen Ermittlungen einschließlich der Außenprüfung auf Ersuchen der zuständigen Finanzbehörde beauftragt werden. Die steuerlichen Ermittlungen beziehen sich auf das Besteuerungsverfahren. Damit ist nicht nur das Festsetzungsverfahren, sondern vielmehr auch das Vollstreckungsverfahren gemeint.
2. Die Steuerfahndung übt die Rechte und Pflichten aus,
a) die den Finanzämtern im Besteuerungsverfahren zustehen (§§ 85 ff.);
b) die sich aus § 404 Satz 2 ergeben: erster Zugriff; Durchsuchung; Beschlagnahme; Durchsicht von Papieren sowie sonstige Maßnahmen nach den für die Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft geltenden Vorschriften.
Die Beamten der Steuerfahndung sind gem.§ 404 Satz 2 letzter Halbsatz AO Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft und somit auch der eigenen Straf- und Bußgeldsachenstelle, wenn diese gem. § 386 Abs. 2 AO das Ermittlungsverfahren in Strafsachen in eigener Zuständigkeit durchführt.
Im Strafverfahren wegen Steuerstraftaten hat die Steuerfahndung dieselben Rechte und Pflichten wie die Behörden und Beamten des Polizeidienstes nach den Vorschriften der Strafprozessordnung.
3. Zu Maßnahmen im Besteuerungsverfahren ist die Steuerfahndung auch berechtigt, wenn bereits ein Steuerstrafverfahren eingeleitet worden ist (vgl. BFH-Beschluss vom 29.10.1986 – I B 28/86 – BStBl 1987 II, S. 440). Für Einwendungen gegen ihre Maßnahmen im Besteuerungsverfahren ist der Finanzrechtsweg, für Einwendungen gegen Maßnahmen im Strafverfahren wegen Steuerstraftaten der ordentliche Rechtsweg gegeben.
4. Für die Steuerfahndung gelten bei der Ermittlung der Besteuerungsgrundlagen und bei Vorfeldermittlungen folgende Einschränkungen aus Vorschriften über das Besteuerungsverfahren nicht (§ 208 Abs. 1 Satz 3):
a) Andere Personen als die Beteiligten können sofort um Auskunft angehalten werden (§ 93 Abs. 1 Satz 3).
b) Das Auskunftsersuchen bedarf entgegen § 93 Abs. 2 Satz 2 nicht der Schriftform.
c) Die Vorlage von Urkunden kann ohne vorherige Befragung des Vorlagepflichtigen verlangt und die Einsichtnahme in diese Urkunden unabhängig von dessen Einverständnis erwirkt werden (§ 97 Abs. 2).
In den Fällen der Buchstaben a) und c) ist § 30a Abs. 5 zu beachten.
5. Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen, die sich aus den Vorschriften über die Außenprüfung ergeben, bleiben bestehen (§ 208 Abs. 1 Satz 3). Die Mitwirkungspflicht kann allerdings nicht erzwungen werden, wenn sich der Steuerpflichtige dadurch der Gefahr aussetzen würde, sich selbst wegen einer von ihm begangenen Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit belasten zu müssen oder wenn gegen ihn bereits ein Steuerstraf- oder Bußgeldverfahren eingeleitet worden ist. 3Über diese Rechtslage muss der Steuerpflichtige belehrt werden.
6. Beamte der Steuerfahndung können mit sonstigen Aufgaben betraut werden (§ 208 Abs. 2).
Die Steuerfahndung ist ein wichtiges Instrument zur Sicherung des Steueraufkommens und zur Wahrung der Steuergerechtigkeit. Die Steuerfahndungsprüfung ist jedoch kein alltägliches Ereignis, sondern eine Ausnahme, die nur bei begründetem Verdacht auf eine steuerliche Straftat oder Ordnungswidrigkeit angewendet wird. Die meisten Steuerpflichtigen haben daher nichts zu befürchten, wenn sie ihre steuerlichen Pflichten korrekt erfüllen.
Zuständiges Finanzamt
Sachliche Zuständigkeit: Das Ermittlungsverfahren führt die Finanzbehörde durch, der die Zuständigkeit nach § 387 Abs. 2 AO übertragen wurde. Daneben kann auch die Finanzbehörde, die die betroffene Steuer verwaltet (§ 387 Abs. 1 AO), im ersten Zugriff den Sachverhalt erforschen und Anordnungen und Maßnahmen nach § 399 Abs. 2 AO treffen.
Örtliche Zuständigkeit: Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus § 388 AO; wegen des Begriffes des Tatortes wird auf § 9 StGB verwiesen. Die örtliche Zuständigkeit bleibt bestehen, wenn die Verwaltungszuständigkeit auf eine andere Finanzbehörde übergeht. Bei Wohnsitzwechsel wird auch die für die Besteuerung neu zuständig werdende Finanzbehörde örtlich zuständig (§ 388 Abs. 2 AO). Bei zusammenhängenden Strafsachen (§ 3 StPO) im Sinne der Nummer 17, für die einzeln verschiedene Finanzbehörden örtlich zuständig wären, ist jede dieser Finanzbehörden für jede der zusammenhängenden Strafsachen zuständig (§ 389 AO). Dies gilt nicht, wenn eine der Straftaten zur Zuständigkeit des Hauptzollamtes und eine andere zur Zuständigkeit des Finanzamtes gehört.
Top Steuerfahndung
Zusammenarbeit im steuerrechtlichen Ermittlungsverfahren zwischen Veranlagungsstellen und BuStra
In der Praxis der Steuerverwaltung kommt es regelmäßig zu Überschneidungen zwischen dem steuerlichen Veranlagungsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungen. Die Zusammenarbeit zwischen den Veranlagungsstellen (auch Veranlagungsbezirk – VTB) und den Bußgeld- und Strafsachenstellen (BuStra) ist dabei von zentraler Bedeutung. Ziel ist es, sowohl eine ordnungsgemäße Besteuerung sicherzustellen als auch etwaige strafrechtliche Konsequenzen bei Steuerstraftaten konsequent zu verfolgen.
Nachforlgend beleuchten wir die wichtigsten Abläufe, Zuständigkeiten und Praxisbeispiele dieser Zusammenarbeit.
1. Verfahrensablauf: Vom Verdacht zur Ermittlung
Meldungen an die BuStra
Ein strafrechtliches Einschreiten setzt voraus, dass ein Anfangsverdacht auf eine Steuerstraftat vorliegt (§ 152 StPO i. V. m. § 370 AO). Solange es sich nur um bloße Vermutungen handelt, verbleibt der Sachverhalt im steuerlichen Veranlagungsverfahren – die zuständige Veranlagungsstelle klärt dann auf eigene Faust auf. Erst wenn sich konkrete Anhaltspunkte verdichten, wird die BuStra involviert.
Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
Die Entscheidung über die Einleitung eines Strafverfahrens liegt grundsätzlich bei der BuStra. Allerdings kann in dringenden Fällen – etwa bei Gefahr im Verzug – auch der Veranlagungsbereich erste Maßnahmen einleiten, insbesondere zur Beweissicherung. Dazu gehören zum Beispiel Aktenvermerke oder Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung von Beweismittelverlusten.
Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen
Wird ein Steuerstrafverfahren eröffnet, bleibt die allgemeine Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen im Besteuerungsverfahren grundsätzlich bestehen. Allerdings sind Zwangsmittel unzulässig, wenn die Mitwirkung zur Selbstbelastung führen könnte (§ 393 AO). Die Trennung von Straf- und Besteuerungsverfahren führt hier zu besonderen Verfahrensfragen – auch für die BuStra.
2. Beispiele für strafrechtlich relevante Sachverhalte
Steuerhinterziehung (§ 370 AO)
Das klassische Beispiel ist die vorsätzliche Abgabe unrichtiger oder unvollständiger Steuererklärungen mit dem Ziel der Steuerverkürzung. Auch der Versuch ist bereits strafbar. Die Strafbarkeit setzt keinen eingetretenen Steuerschaden voraus – es genügt die Absicht, Steuern zu hinterziehen.
Pflichtwidriges Unterlassen
Auch die Nichtabgabe von Steuererklärungen, insbesondere trotz Aufforderung durch das Finanzamt, kann den Verdacht einer Steuerhinterziehung durch Unterlassen (§ 370 Abs. 1 Nr. 2 AO) begründen. Das gilt insbesondere, wenn die Erklärungspflicht offensichtlich ist (z. B. bei erkennbaren Einkünften) und ein steuerlich relevanter Zeitraum betroffen ist.
Selbstanzeige (§ 371 AO)
Wird eine Selbstanzeige erstattet, ist sie durch die BuStra zu prüfen. Nur wenn die Steuern vollständig und fristgerecht nachentrichtet wurden und keine Sperrgründe vorliegen (z. B. Bekanntgabe einer Prüfungsanordnung), ist die Selbstanzeige strafbefreiend. In Zweifelsfällen informiert der VTB die BuStra, um die Wirksamkeit der Selbstanzeige sicherzustellen.
3. Sonstige Aspekte aus dem Steuerstrafverfahren
Hinterziehungszinsen (§ 235 AO)
Liegt eine vollendete Steuerhinterziehung vor, sind Hinterziehungszinsen von 0,5 % pro Monat auf den hinterzogenen Steuerbetrag festzusetzen – unabhängig vom Strafmaß. Die Festsetzungsfrist beginnt mit der Rechtskraft des Steuerstrafverfahrens und beträgt ein Jahr.
Zeugenaussagen von Beamten
Finanzbeamte dürfen in einem Steuerstrafverfahren nur mit Genehmigung ihrer vorgesetzten Dienststelle aussagen (§ 30 AO). Dabei ist das Steuergeheimnis strikt zu beachten – insbesondere im Hinblick auf Informationen, die außerhalb des Strafverfahrens erhoben wurden.
Nichtsteuerliche Verfehlungen
Stößt die Finanzverwaltung auf nichtsteuerliche Straftaten (z. B. Urkundenfälschung, Insolvenzverschleppung), dürfen diese nur unter Beachtung des Steuergeheimnisses an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden gemeldet werden. Eine automatische Übermittlung ist unzulässig.
4. Kommunikation und Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit zwischen BuStra und Veranlagungsstellen ist mehr als ein reiner Austausch von Informationen – sie ist eine Verzahnung von Verwaltung und Strafverfolgung. Die BuStra informiert die Veranlagungsstelle über:
- Einleitung, Verlauf und Abschluss des Ermittlungsverfahrens,
- strafrechtliche Erkenntnisse, die für das Besteuerungsverfahren relevant sind,
- sowie ggf. über erforderliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr oder Beweissicherung.
Diese Rückmeldungen sind essenziell für eine korrekte Veranlagung und ermöglichen es dem VTB, das Besteuerungsverfahren zügig weiterzuführen – ggf. mit geänderten Festsetzungen oder Ergänzungsbescheiden.
Fazit
Die Grenze zwischen steuerlicher Prüfung und strafrechtlicher Verfolgung ist in der Praxis oft fließend. Eine enge, rechtskonforme und abgestimmte Zusammenarbeit zwischen Veranlagungsstellen und BuStra ist entscheidend, um Steuerausfälle zu vermeiden, rechtsstaatliche Verfahren sicherzustellen und sowohl fiskalische als auch strafrechtliche Interessen zu wahren.
Dabei gilt: Nicht jeder Fehler ist ein Verbrechen – aber wo der Verdacht konkret wird, beginnt die Arbeit der BuStra.
Ablauf + Verhaltensregeln
Steuerfahndung vor der Tür: Was tun?
Die Konfrontation mit der Steuerfahndung löst bei vielen Menschen große Besorgnis aus. Die bloße Vorstellung, dass Steuerfahnder unangekündigt vor der Tür stehen könnten, ist für die meisten eine beunruhigende Angelegenheit. Aber was bedeutet es eigentlich, wenn die Steuerfahndung aktiv wird, und welche Rechte und Pflichten haben Sie in so einem Fall? Ich gehe auf diese Fragen ein und bieten Ihnen Handlungsempfehlungen, wie Sie sich verhalten sollten, um Ihre Rechte zu wahren – insbesondere im Hinblick auf die nachfolgende Steuerfestsetzung.
Die erste Konfrontation mit der Steuerfahndung erfolgt häufig durch eine Hausdurchsuchung und die Beschlagnahme von Unterlagen und Datenträgern. In dieser kritischen Phase ist die Unterstützung durch einen erfahrenen Steuerberater unerlässlich. Ein Steuerberater kann die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen prüfen und sicherstellen, dass Ihre Rechtsposition nicht durch mögliche Zufallsfunde weiter geschwächt wird.
Anzeichen für eine Hausdurchsuchung
Eine Hausdurchsuchung durch die Steuerfahndung kann sehr einschüchternd sein. Wichtig ist, dass Sie vorbereitet sind und wissen, auf welche Anzeichen Sie achten müssen. Hinweise können Informationen über Ermittlungsmaßnahmen sein, die Ihnen zu Ohren kommen, oder Andeutungen im Rahmen einer Betriebsprüfung. Auch Ihr Steuerberater könnte in einem anderen Zusammenhang von solchen Ermittlungen erfahren.
Tipp: Steuerpflichtige, die Maßnahmen der Steuerfahndung befürchten, durch eine rechtzeitige und korrekte Selbstanzeige diese Maßnahmen verhindern können. Im internationalen Kontext müssen Durchsuchungsanträge und die Feststellung der Steuerpflicht sorgfältig begründet werden.
Unangekündigte Wohnungsbesichtigung durch die Steuerfahndung
Wenn ein Steuerfahnder unangekündigt vor Ihrer Tür steht, kann das eine beunruhigende Situation sein. Viele Menschen sind unsicher, wie sie sich verhalten sollen und ob sie den Steuerfahnder in ihre Wohnung lassen müssen. Ein Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 12. Juli 2022 bietet hierzu wichtige Orientierung.
Was prüft die Steuerfahndung?
Die Steuerfahndung ist eine besondere Form der Steuerprüfung, die bei Verdacht auf Steuerhinterziehung oder andere Steuerstraftaten durchgeführt wird. Die Steuerfahndungsprüfung unterscheidet sich von einer normalen Betriebsprüfung in mehreren Punkten. Zum einen hat die Steuerfahndung mehr Befugnisse, wie zum Beispiel das Recht, Geschäftsräume und Wohnungen zu durchsuchen, Beweismittel zu beschlagnahmen oder Zeugen zu vernehmen. Zum anderen gelten für die Steuerfahndungsprüfung andere Verfahrensregeln, wie zum Beispiel die Pflicht, den Beschuldigten über seine Rechte zu belehren oder die Möglichkeit, einen Verteidiger zu beauftragen.
Die Steuerfahndungsprüfung kann sich auf alle Steuerarten beziehen, die der Finanzverwaltung unterliegen, wie zum Beispiel Einkommensteuer, Umsatzsteuer oder Körperschaftsteuer. Die Steuerfahndung prüft dabei vor allem, ob der Steuerpflichtige seine steuerlichen Pflichten erfüllt hat, wie zum Beispiel die Abgabe von Steuererklärungen, die Führung von Büchern und Aufzeichnungen oder die Zahlung von Steuern. Die Steuerfahndung kann auch Sachverhalte aufdecken, die der Steuerpflichtige absichtlich oder fahrlässig verschwiegen oder falsch dargestellt hat, wie zum Beispiel unversteuerte Einnahmen, nicht abgeführte Lohnsteuern oder Scheinrechnungen.
Wann müssen Sie einen Steuerfahnder hereinlassen?
Der BFH betonte den Schutz der Unverletzlichkeit der Wohnung, der im Grundgesetz verankert ist. Eine Wohnung darf demnach nur dann besichtigt werden, wenn Unklarheiten nicht durch andere Mittel geklärt werden können. Selbst wenn eine Zustimmung zur Besichtigung vorliegt, ist diese unter bestimmten Umständen nicht ausreichend. Insbesondere dann, wenn die Maßnahme von einem Steuerfahnder und nicht von einem Mitarbeiter der Veranlagungsstelle durchgeführt wird, kann dies als rechtswidrig angesehen werden. Der Einsatz eines Steuerfahnders birgt zudem die Gefahr, das persönliche Ansehen der betroffenen Person zu gefährden.
Eine selbstständige Unternehmensberaterin, die in ihrer Einkommensteuererklärung erstmals Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer geltend machte, wurde unerwartet von einem Steuerfahnder besucht. Dieser wollte die Angaben zur Wohnung überprüfen. Die Frau ließ den Steuerfahnder ein, legte aber später Einspruch gegen das Vorgehen ein. Der BFH urteilte, dass die Besichtigung rechtswidrig war.
Das Urteil des BFH unterstreicht die Bedeutung des Schutzes der Privatsphäre und setzt klare Grenzen für die Befugnisse der Steuerfahndung. Wenn Sie mit einer solchen Situation konfrontiert sind, ist es wichtig, Ihre Rechte zu kennen und gegebenenfalls professionelle rechtliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen
Was können Sie tun, wenn die Steuerfahndung vor der Tür steht?
- Informieren Sie sich über den Grund des Besuchs: Die Steuerfahndung muss Ihnen mitteilen, wenn Ihnen eine Steuerstraftat oder -ordnungswidrigkeit vorgeworfen wird.
- Verlangen Sie den Durchsuchungsbeschluss: Bevor Sie die Steuerfahndung in Ihre Geschäfts- oder Wohnräume lassen, sollten Sie den gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss einfordern. Ohne einen solchen Beschluss haben Sie das Recht, den Zutritt zu verweigern.
- Anwesenheit bei der Durchsuchung: Sie haben das Recht, bei der Durchsuchung anwesend zu sein. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, Fragen zu beantworten, die den Tatvorwurf betreffen, da Sie sich nicht selbst belasten müssen.
Notfallplan bei drohender Durchsuchung
Was darf die Steuerfahndung?
Die Steuerfahndung hat weitreichende Befugnisse, um die Einhaltung der Steuergesetze zu überwachen und Steuerstraftaten zu verfolgen. Sie darf sowohl Geschäfts- als auch Wohnräume durchsuchen, sofern ein berechtigter Verdacht besteht und belastendes Material erwartet wird. Ein solcher Einsatz muss jedoch nicht angekündigt werden, erfordert aber einen gerichtlichen Durchsuchungsbeschluss.
Fahndungsdurchsuchung, Haftbefehl, Vermögensarrest
Verhalten bei einer Hausdurchsuchung
Wenn die Steuerfahndung mit einem Durchsuchungsbeschluss erscheint, haben Sie das Recht, bei der Durchsuchung anwesend zu sein. Sie sind jedoch nicht verpflichtet, Fragen zum Tatvorwurf zu beantworten, da Sie sich nicht selbst belasten müssen. Die Begleitung durch einen Steuerberater ist in dieser Situation von größter Bedeutung. Er sorgt dafür, dass die Durchsuchung und Beschlagnahmung rechtmäßig erfolgen und Ihre Rechte gewahrt bleiben. Die Ergebnisse der Durchsuchung können sowohl für das strafrechtliche Verfahren als auch für die spätere Steuerfestsetzung entscheidend sein.
Angemessenheit der Art und Weise der Fahndung/ Verhaftung?
|
Tatbestand |
Konsequenz |
|
Die Steuerfahndung klingelt und fordert Zutritt. |
Zunächst Dienstmarke, Dienstausweis und Durchsuchungsbefehl verlangen. |
|
Der Zutritt wird verweigert. |
Die Fahnder dürfen sich gewaltsam Zutritt verschaffen. |
|
Es wird zunächst gar nicht geöffnet. |
Die Fahnder dürfen sich gewaltsam Zutritt verschaffen. |
|
Der Beschuldigte ist nicht zu Hause. |
Die Fahnder dürfen trotzdem durchsuchen. |
|
Der Fahnder betritt das Unternehmen. |
Personal darf den Zutritt nicht verweigern. Oberster Grundsatz: Keinerlei Aussage vor Konsultation des Verteidigers und vor Akteneinsicht. |
|
Betriebsprüfer findet belastendes Material, befindet, dass Gefahr im Verzug ist, und wird selbst zum Fahnder. |
Der Beamte muss den Beschuldigten auf sein Recht der Mitwirkungsverweigerung hinweisen, ansonsten: Verwertungsverbot. |
|
Prüfung des Durchsuchungsbeschlusses |
Durchsuchungsbeschluss muss von einem Richter auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder Straf- und Bußgeldstelle des Finanzamts ausgestellt sein. Wenn nicht: Die Beamten dürfen nicht durchsuchen. Wenn doch durchsucht wird: Verwertungsverbot. Genannt sein muss die Steuerart, in der ermittelt und wo durchsucht wird (Name/Firma, Ort, Straße, Hausnummer) und eine Lebenssachverhaltsskizze, die den Tatvorwurf umschreibt (Wahrung des Bestimmtheitsgrundsatzes). Wenn nicht: Durchsuchung verweigern. Beschuldigung ist nur vage formuliert. Protest i.d.R. nutzlos. |
|
Fahndung ohne Durchsuchungsbeschluss |
Grds. unzulässig, "Gefahr im Verzug" liegt i.d.R. nicht vor (BVerfG, Urteil v. 21.11.2000, 2 BvR 1444/00). |
|
Beschuldigter will telefonieren |
Mit Familie, Firma, Steuerberater, Rechtsanwalt Es ist das Recht des Beschuldigten, allein telefonieren zu dürfen. Der Beschuldigte sollte zunächst Steuerberater und/oder Rechtsanwalt kontaktieren und gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass an allen Örtlichkeiten, an denen Fahnder in seiner Sache vor Ort sind (Wohnung, Firma, Zweigniederlassung, Feriendomizil) Personen seines Vertrauens die Durchsuchungen begleiten und protokollieren (seine Rechte wahrnehmen). |
|
Anweisungen erteilen |
Beschuldigter darf auch allein mit Mitarbeitern, Angehörigen usw. sprechen und Anweisungen erteilen. Dritte sollten keinerlei Auskunft geben, sich passiv verhalten und keine Unterlagen ohne Einwilligung des Beschuldigten herausgeben. |
|
Durchsuchung als solches |
Die Fahnder dürfen alles durchsuchen. Werden die gesuchten Sachen freiwillig herausgegeben, ist die Durchsuchung beendet. Eine weitere Suche ist rechtswidrig: Verwertungsverbot. |
|
Es drohen Zufallsfunde. |
In Absprache mit dem Steuerberater/Rechtsanwalt kooperieren. |
|
Verlassen der Fahndungsörtlichkeit |
Beschuldigter: Die Fahnder dürfen bei Verdunkelungsgefahr eine vorläufige Festnahme aussprechen, Gleiches droht auch möglichen Mittätern (Ehegatten, Mitgesellschaftern usw.). Grundsätzlich Vertreter benennen. Alle anderen Dritten: Dürfen den Fahndungsort verlassen; Taschendurchsuchungen und Leibesvisitationen sind zulässig. |
|
Aktenbeschlagnahmung |
Soweit sie der Beweissicherung dienen: zulässig. Beschlagnahmung "auf Vorrat": unzulässig. Bei unzulässigen Beschlagnahmungen Protest einlegen, ggf. bei Gericht Herausgabe beantragen. Auf Aufforderung müssen die Fahnder eine genaue Liste aller beschlagnahmten Ordner und Papiere anfertigen; es besteht das Recht, Kopien zu fertigen. |
|
Telefonüberwachung |
Besteht der Anfangsverdacht einer bandenmäßigen Steuerhinterziehung, so kommt die gerichtliche Anordnung einer Telefonüberwachung in Betracht, die immer häufiger praktiziert wird, um auf unkonventioneller Basis vermeintliches Belastungsmaterial zu erlangen. |
Fazit
Der Umgang mit der Steuerfahndung ist eine ernste Angelegenheit und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Rechte und Pflichten kennen. Ein Steuerberater kann Ihnen dabei helfen, den Prozess korrekt und ohne rechtliche Nachteile zu durchlaufen. Mit professioneller Unterstützung können Sie den Umgang mit dem Finanzamt und der Steuerfahndung meistern.
Top Steuerfahndung
Anweisungen für das Straf- und Bußgeldverfahren (Steuer) – AStBV (St) 2025 vom 7. Februar 2025
Am 7. Februar 2025 wurden die Anweisungen für das Straf- und Bußgeldverfahren (Steuer) – kurz AStBV (St) 2025 – veröffentlicht. Mit Wirkung ab 1. April 2025 ersetzen sie die bisherige Fassung 2023/2024. Diese Neufassung bringt zahlreiche praxisrelevante Anpassungen, die für Unternehmen, Steuerberater und Steuerpflichtige von Bedeutung sind.
In diesem Beitrag möchten wir Ihnen einen verständlichen Leitfaden bieten: Welche Änderungen treten in Kraft? Was bedeuten sie für Betroffene? Und wie kann eine sachgerechte Verteidigungsstrategie aussehen?
1. Bedeutung und Geltungsbereich der AStBV (St)
Die AStBV (St) sind interne Verwaltungsvorschriften der Finanzverwaltung, vergleichbar mit den RiStBV (Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren im allgemeinen Bereich). Sie gelten ausschließlich für steuerstrafliche Verfahren (Steuerdelikte und Steuerordnungswidrigkeiten) und sind verbindlich für die Bediensteten der Finanzbehörden, Steuerfahndung etc.
Für den Beschuldigten und seinen Verteidiger haben sie grundsätzlich keine unmittelbare Außenwirkung (sie begründen kein subjektives Recht). Allerdings kann sich eine Selbstbindung der Verwaltung ergeben, insbesondere wenn vertraulich und gerecht verfahren werden soll (z. B. Gleichbehandlungsgrundsatz).
2. Zentrale Änderungen und Neuerungen im Überblick
Die AStBV (St) 2025 nehmen zahlreiche Anpassungen vor – hier die wichtigsten aus Sicht der Praxis:
| Themenkomplex | Wichtige Neuregelungen / Anpassungen | Bedeutung für Betroffene / Steuerberatung |
|---|---|---|
| Energiepreispauschale | Neu aufgenommen: Straftaten im Zusammenhang mit der Energiepreispauschale (§ 121 EStG) sind ausdrücklich erfasst. | Fälle, die bislang ggf. nicht als steuerstrafrechtlich behandelt wurden, können nun in den Fokus rücken. |
| Akteneinsichtsrecht / Fallhefte | Die Verwaltung bestätigt weiterhin, dass Verteidigern kein Einblick in Fallhefte oder Handakten der Steuerfahndung bzw. Betriebsprüfung gewährt wird (z. B. Nr. 35 Abs. 4). | Verteidiger müssen alternative Wege suchen, um informationelle Lücken zu schließen (z. B. über § 78 FGO). |
| Freiwillige Raum- bzw. Daten-Durchsicht | Neue Belehrungspflicht: Wer freiwillig zustimmt, muss nicht nur über sein Widerrufsrecht, sondern auch über den Zweck der Datenverarbeitung informiert werden (Nr. 65). | Die Form und der Inhalt der Einwilligung sind sorgfältig zu prüfen — Fehler können die Verwertbarkeit gefährden. |
| Durchsuchung der Familienwohnung | Klarstellung: Ein Durchsuchungsbeschluss gegen einen Beschuldigten erlaubt grundsätzlich auch die Durchsuchung der gesamten Familienwohnung, sofern Räume baulich nicht ausgeschlossen sind (Nr. 67 S. 3). | Für Mitbewohner und Familienmitglieder besteht kaum Rückzugsraum; Verteidiger müssen die Abgrenzung bonitätsgerecht prüfen. |
| Digitale Durchsicht und IT-Zugriff | Präzisierungen: Zugriff auf Clouddienste, Online-Marktplätze, Social Media und passwortgeschützte Daten möglich. Die Sichtung soll zeitnah zur Durchsuchung erfolgen. | IT-Sicherheit und Dokumentation wird noch wichtiger. Mandanten und Berater sollten Zugriffsrechte, Protokollierung und Datenhaltung kritisch prüfen. |
| Bußgeld- / Ordnungswidrigkeiten-Schwellen | Bei Bagatellfällen (z. B. unter 10.000 € und Verzögerung unter 3 Monaten) soll grundsätzlich nicht verfolgt werden, sofern kein besonders vorwerfbares Verhalten vorliegt (Nr. 104 Abs. 3). | Gerade kleinere Verstöße könnten künftig weniger aggressiv verfolgt werden – eine Chance für eine pragmatische Mandatsführung. |
| Pflichtverteidiger & Verwertungsverbot | Die unterlassene Bestellung eines Pflichtverteidigers führt nicht automatisch zu einem Verwertungsverbot (Nr. 150 Abs. 4 S. 3). Im Einzelfall kann aber ein relatives Verwertungsverbot in Betracht kommen. | Verteidigung muss prüfen, ob ein Antrag auf Verwertungsverbot gerechtfertigt ist, z. B. wegen bewusster Unterlassung oder Unmöglichkeit eines Verteidigers. |
Diese Auswahl ist nicht abschließend — die Neufassung enthält noch weitere redaktionelle und strukturelle Anpassungen, insbesondere im Bereich Strafzumessung (Nr. 77) u. a.
3. Praktische Handlungsanweisungen für Mandanten & Berater
Um Mandanten bestmöglich zu schützen und Risiken zu minimieren, empfehlen sich die nachfolgenden Schritte:
- Frühzeitige Prüfung & Risikoanalyse: Schon bei ersten Anzeichen steuerlicher Unregelmäßigkeiten sollte eine Einschätzung erfolgen: Könnte dies in ein steuerstrafrechtliches Verfahren übergehen? Wird IT-Zugriff verlangt?
- Strukturierte Dokumentation & Datenschutz: Zugriffsrechte auf digitale Plattformen (insbesondere Cloud, Social Media, Marktplätze) sollten klar geregelt und protokolliert sein. Einwilligungen zur freiwilligen Durchsicht müssen schriftlich erfolgen und alle Belehrungspflichten abdecken.
- Verteidigungsstrategie vorbereiten: Prüfen, ob ein Verwertungsverbot geltend gemacht werden kann. Strategisch überlegen, ob und wie Einspruch oder Klage genutzt werden kann.
- Mandantenaufklärung & Mandatsvereinbarung: Mandant:innen müssen über die möglichen Risiken bei freiwilliger Daten- oder Raumzugeständnis aufgeklärt werden.
- Kooperation mit IT-Sicherheit & Forensik: Bei digitalen Ermittlungen kann es sinnvoll sein, frühzeitig IT-Forensiker hinzuzuziehen, um Beweise zu sichern und eigene Gutachten zur Verteidigung zu erhalten.
4. Risiken und Stolperfallen
- Unklare Einwilligungen bei freiwilliger Daten-/Raumdurchsicht führen zu formellen Angriffspunkten.
- Verspätete Verteidigungsaufnahme kann dazu führen, dass entscheidende Daten schon ausgewertet wurden oder verloren sind.
- Überschätzung der Verwertungsverbotsmöglichkeiten: Nicht jede fehlerhafte Verfahrensweise führt zu einem Verwertungsverbot.
- Unkenntnis über Datendomizile: Bei internationalen Cloud-Anbietern ist nicht immer klar, wo die Daten tatsächlich physisch liegen.
- Fehlende Vorbereitung auf digitale Durchsicht: Wer keine Zugriffskontrollen eingerichtet hat, macht sich angreifbar.
5. Fazit & Ausblick
Mit den AStBV (St) 2025 erlebt das steuerstrafrechtliche Verfahrensverfahren eine Modernisierung, insbesondere im Bereich der digitalen Ermittlungen und der Belehrungspflichten. Für Mandanten und Steuerberater ergeben sich neue Chancen, aber auch erhebliche Risiken — insbesondere bei unzureichender Vorbereitung.
Eine vorausschauende, technische und rechtlich fundierte Mandatsführung ist unerlässlich. Insbesondere:
- Transparente und rechtskonforme Einwilligungen bei freiwilligen Datenzugriffen,
- gründliche Dokumentation und IT-Sicherheitsmaßnahmen,
- strategische Verteidigungsplanung,
- und frühzeitige Einbindung von Fachleuten (etwa IT-Forensik)
sind zentrale Bausteine.
Sprechen Sie uns an
Wenn Sie zu einem konkreten Fall Fragen haben oder eine individuelle Bewertung Ihrer Situation wünschen, sprechen Sie uns gerne an. Wir beraten Sie vertrauensvoll durch jedes steuerstraf- oder bußgeldrechtliche Verfahren – von der Risikoanalyse über die Verteidigung bis zur optimalen Lösung.
Top Steuerfahndung
Checkliste für Mandanten: Verhalten bei einer Steuerfahndung
Eine Durchsuchung durch die Steuerfahndung ist für jeden Betroffenen eine Stresssituation. Mit der richtigen Vorbereitung und dem passenden Verhalten können jedoch unnötige Risiken vermieden werden.
1. Sofortmaßnahmen bei Erscheinen der Steuerfahndung
- Ruhe bewahren – keine Panik, keine spontanen Erklärungen.
- Dienstausweise und Durchsuchungsbeschluss verlangen (Prüfen, ob alle Räume/Personen erfasst sind).
- Keine freiwillige Herausgabe ohne Beschluss – außer auf anwaltlichen Rat.
- Keine Angaben zur Sache machen (Schweigen ist Ihr gutes Recht!).
- Anwalt / Steuerberater sofort informieren und Hinzuziehung verlangen.
- Mitarbeiter informieren: Niemand darf ohne Erlaubnis der Fahnder Räume betreten oder verlassen.
2. Verhalten während der Durchsuchung
- Kooperation, aber keine Aussagen: Höflich bleiben, keine Widerstände leisten.
- Keine Erklärungen abgeben, auch nicht „im Smalltalk“.
- Protokoll führen: Notieren, was beschlagnahmt oder kopiert wird.
- Beschlagnahmeverzeichnis verlangen – die Fahnder müssen dokumentieren, welche Unterlagen/Daten sie mitnehmen.
- Digitale Daten: Passwörter nicht freiwillig herausgeben, außer dies ist zwingend durch Beschluss angeordnet.
- Kopien anfordern: Von beschlagnahmten Geschäftsunterlagen sollten nach Möglichkeit Kopien erstellt werden.
3. Nach der Durchsuchung
- Sofort Rücksprache mit dem Verteidiger / Steuerberater halten: Gemeinsame Analyse der Situation.
- Dokumentation sichern: Notizen über Ablauf, Verhalten der Fahnder, geführte Gespräche sofort festhalten.
- Keine nachträglichen Erklärungen ohne anwaltliche Abstimmung abgeben.
- Fristen beachten: Rechtsmittel gegen Maßnahmen sind oft nur innerhalb weniger Tage möglich.
4. Präventive Vorbereitung (empfohlen)
- Notfallplan erstellen: Zuständiger Ansprechpartner in der Kanzlei/Verteidigung, erreichbare Telefonnummern.
- Mitarbeiterschulung: Alle Beschäftigten sollten wissen, wie sie sich verhalten (z. B. Schweigerecht, Anwalt rufen).
- Dokumentenmanagement: Wichtige Unterlagen geordnet bereithalten, digitale Zugänge absichern.
- IT-Check: Regelmäßige Überprüfung der Zugriffsrechte und Datensicherheit.
5. Die wichtigsten „Don’ts“
- Keine freiwilligen Aussagen („das war nur ein Versehen“).
- Keine Unterlagen verstecken oder vernichten – das ist strafbar.
- Keine eigenmächtigen Erklärungen gegenüber Mitarbeitern oder Presse.
- Keine freiwillige Herausgabe ohne anwaltliche Prüfung.
Fazit
Bei einer Steuerfahndung gilt: Schweigen, Unterlagen sichern, Anwalt informieren.
Alles Weitere sollte von Fachleuten gesteuert werden, um Schaden zu begrenzen und eine klare Verteidigungsstrategie zu entwickeln.
Top Steuerfahndung
FAQ: Steuerfahndung – Die wichtigsten Fragen und Antworten
- Verdacht auf Steuerhinterziehung,
- falschen oder unterlassenen Angaben in Steuererklärungen,
- anonymen Anzeigen oder Hinweisen,
- Ergebnissen aus Betriebsprüfungen,
- oder Hinweisen aus internationalen Datenbanken (z. B. Panama Papers, Cum-Ex).
- Wohnungen, Geschäftsräume und Fahrzeuge durchsuchen,
- Unterlagen und digitale Daten beschlagnahmen,
- Konten und Bankunterlagen einsehen,
- Zeugen und Beschuldigte vernehmen,
- mit der Polizei oder Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten.
- Ruhe bewahren – keine Panikreaktionen.
- Durchsuchungsbeschluss verlangen und prüfen.
- Keine Aussagen machen – Sie haben ein Schweigerecht.
- Anwalt / Steuerberater sofort informieren.
- Alles dokumentieren: Wer war da, was wurde mitgenommen?
- bis 50.000 €: Geldstrafe, oft noch Einstellung gegen Auflage möglich,
- 50.000 € – 100.000 €: Geldstrafe oder Freiheitsstrafe auf Bewährung,
- 100.000 € – 1.000.000 €: regelmäßig Freiheitsstrafe auf Bewährung,
- über 1.000.000 €: in der Regel Freiheitsstrafe, auch ohne Bewährung möglich.
- die Steuerfahndung noch nicht tätig geworden ist,
- alle unrichtigen Angaben vollständig berichtigt werden,
- und die hinterzogenen Steuern plus Zinsen rechtzeitig gezahlt werden.
Sobald die Fahnder vor der Tür stehen, ist es meist zu spät.
- Steuerstraftaten: grundsätzlich 5 Jahre,
- bei besonders schwerer Steuerhinterziehung: bis zu 10 Jahre,
- steuerliche Festsetzungsfristen können sogar 10 Jahre betragen.
- Keine Unterlagen verstecken oder vernichten – das verschlimmert die Lage.
- Keine vorschnellen Aussagen ohne anwaltlichen Beistand.
- Keine Konfrontation mit den Fahndern – Kooperation ja, Aussagen nein.
- Sie selbst kennen oft nicht den vollständigen Umfang der Ermittlungen.
- Jeder Fehler in der ersten Phase kann später kaum korrigiert werden.
- Ein Fachanwalt/Steuerberater sorgt dafür, dass Ihre Rechte gewahrt bleiben und die Verteidigung auf Augenhöhe mit den Ermittlungsbehörden erfolgt.
Fazit: Bei einer Steuerfahndung gilt: Schweigen, Unterlagen sichern, Verteidiger informieren. Wer vorbereitet ist, schützt sich vor unnötigen Risiken und hat bessere Chancen auf eine schnelle Lösung.
Aktuelles + weitere Infos
Rechtsgrundlagen zum Thema: Steuerfahndung
AOAO § 117a Übermittlung personenbezogener Daten an Mitgliedstaaten der Europäischen Union
AO § 117b Verwendung von den nach dem Rahmenbeschluss 2006/960/JI des Rates übermittelten Daten
AO § 171 Ablaufhemmung
AO § 208 Steuerfahndung (Zollfahndung)
AO § 404 Steuer- und Zollfahndung
AO § 117a Übermittlung personenbezogener Daten an Mitgliedstaaten der Europäischen Union
AO § 117b Verwendung von den nach dem Rahmenbeschluss 2006/960/JI des Rates übermittelten Daten
AO § 171 Ablaufhemmung
AO § 208 Steuerfahndung (Zollfahndung)
AO § 404 Steuer- und Zollfahndung
AEAO
AEAO Zu § 1 Anwendungsbereich:
AEAO Zu § 30 Steuergeheimnis:
AEAO Zu § 85 Besteuerungsgrundsätze:
AEAO Zu § 93 Auskunftspflicht der Beteiligten und anderer Personen:
AEAO Zu § 153 Berichtigung von Erklärungen:
AEAO Zu § 171 Ablaufhemmung:
AEAO Zu § 173 Aufhebung oder Änderung von Steuerbescheiden wegen neuer Tatsachen oder Beweismittel:
AEAO Zu § 193 Zulässigkeit einer Außenprüfung:
AEAO Zu § 196 Prüfungsanordnung:
AEAO Zu § 208 Steuerfahndung, Zollfahndung:
BpO 2
EStH 4.9
 Steuer-Newsletter
Steuer-Newsletter