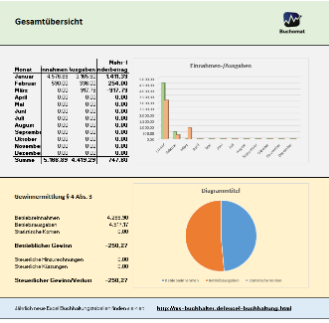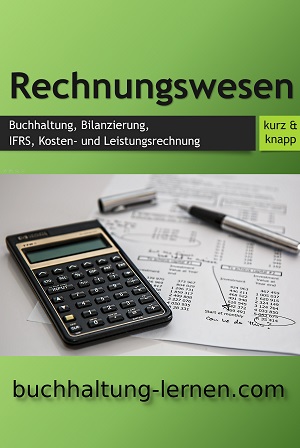Unterhaltsrechner & Unterhaltsberechnung
Wie viel Unterhalt muss ich für mein Kind / Ex-Partner zahlen?
Inhalt:
Unterhaltsberechnung nach Düsseldorfer Tabelle
Ermitteln Sie mit dem Unterhaltsrechner den Unterhalt nach Düsseldorfer Tabelle:
Düsseldorfer Tabelle Rechner

Düsseldorfer Tabelle
Was ist die Düsseldorfer Tabelle?
Die Düsseldorfer Tabelle enthält Leitlinien für den Unterhaltsbedarf von Unterhaltsberechtigten, insbesondere zur Unterhaltsberechnung zum Kindesunterhalt für minderjährige und volljährige Kinder aber auch für Ehegatten (siehe auch zum sog Ehegattenunterhalt & Realsplitting).
Das Wichtigste in Kürze
- Unterhaltspflicht besteht bis zur Volljährigkeit und darüber hinaus bis zum Abschluss der ersten Berufsausbildung bzw. eines Erststudiums.
- Der betreuende Elternteil leistet Naturalunterhalt (Wohnung, Essen, Kleidung, Betreuung).
- Der andere Elternteil ist barunterhaltspflichtig – orientiert an der Düsseldorfer Tabelle 2025.
- Kindergeld wird auf den Barunterhalt angerechnet (hälftig bei Minderjährigen, vollständig bei Volljährigen).
- BAföG, Ausbildungsvergütung & Stipendien können den Unterhaltsbedarf mindern.
Wenn Sie wissen möchten, wie viel Kindesunterhalt Sie nach einer Trennung und/ oder Scheidung für die gemeinsamen Kinder bezahlen müssen, gibt Ihnen die Düsseldorfer Tabelle entsprechend Auskunft. Diese Tabelle ist eine bundesweit anerkannte Richtlinie zum Unterhaltsbedarf, wird vom Oberlandesgericht Düsseldorf stetig aktualisiert und entsteht in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Familiengerichtstag. Sie dient nicht nur als Leitlinie für die Gerichte, sondern enthält auch ergänzende Anmerkungen.
Die Düsseldorfer Tabelle wird durch ergänzende Unterhaltsleitlinien der einzelnen Oberlandesgerichte, die zusätzliche Erläuterungen enthalten, ergänzt. Ziel ist es, die Unterhaltsrechtsprechung der Familiengerichte in Bezug auf den Unterhalt zu standardisieren und damit gerechter zu gestalten.
Die Düsseldorfer Tabelle besteht aus vier Teilen:
- dem Kindesunterhalt,
- dem Ehegattenunterhalt,
- der Mangelfallberechnung und
- dem Verwandtenunterhalt.
Die Tabelle hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt eine Richtlinie dar. Sie weist den monatlichen Unterhaltsbedarf aus, bezogen auf zwei Unterhaltsberechtigte, ohne Rücksicht auf den Rang. Der Bedarf ist nicht identisch mit dem Zahlbetrag; dieser ergibt sich unter Berücksichtigung der nachfolgenden Anmerkungen.
Wer ist unterhaltspflichtig?
Nach Trennung oder Scheidung wird festgelegt, bei welchem Elternteil das Kind seinen Lebensmittelpunkt hat. Dieser Elternteil erbringt den Naturalunterhalt (Wohnung, Verpflegung, Betreuung, Kleidung).
Der andere Elternteil ist barunterhaltspflichtig. Die Höhe richtet sich nach der Düsseldorfer Tabelle 2025.
Bei volljährigen Kindern in Ausbildung oder Studium sind beide Elternteile anteilig nach Leistungsfähigkeit barunterhaltspflichtig.
Ermittlung des Unterhalts
Grundlage ist die Düsseldorfer Tabelle 2025 sowie das bereinigte Nettoeinkommen.
Tipp: Einkommen vorab anwaltlich prüfen lassen, um Abzüge korrekt zu berücksichtigen (Fahrtkosten, Kredite, Umgangskosten etc.).
Wovon hängt die Höhe des Kindesunterhalts ab?
Der Unterhalt berechnet sich nach:
- Nettoeinkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils
- Alter des Kindes (Altersstufen der Düsseldorfer Tabelle)
- Kindergeldanrechnung
- Selbstbehalt (Eigenbedarf des Unterhaltspflichtigen)
- Einkünfte des Kindes (BAföG, Nebenjob, Ausbildungsvergütung)
- Sonderbedarf (z. B. Klassenfahrt, Laptop, Zahnspange)
Aktuelle Mindestunterhaltssätze 2025 (Düsseldorfer Tabelle)
- 0–5 Jahre: 480 €
- 6–11 Jahre: 551 €
- 12–17 Jahre: 645 €
- Volljährige im Haushalt: 628 €
Kindergeld wird hälftig (minderjährig) bzw. vollständig (volljährig) angerechnet.
BAföG, Kindergeld & Unterhalt – wie wird angerechnet?
BAföG-Leistungen – insbesondere Zuschussanteile – können den Unterhaltsbedarf mindern. Kindergeld verringert stets den Barunterhalt.
Ausbildungsvergütung wird mit Freibeträgen angerechnet (§ 1610 BGB, §§ 11, 21 BAföG).
Krankenkasse & Kindesunterhalt
- Unter 25: Familienversicherung möglich
- Bei eigenem Einkommen über der Geringfügigkeitsgrenze → Pflichtversicherung
- Während des Studiums: studentische KV möglich
Was tun, wenn Kindesunterhalt nicht gezahlt wird?
- Jugendamt einschalten → Unterhaltstitel erstellen lassen
- Titel kann gepfändet / vollstreckt werden
- Unterhaltsvorschuss ist möglich, wenn Zahlungen dauerhaft ausbleiben
Download Düsseldorfer Tabelle
Düsseldorfer Tabelle 2025: Kindesunterhalt, Bedarfssätze & Kindergeld
Die Düsseldorfer Tabelle 2025 ist die zentrale Orientierungshilfe zur Berechnung des Kindesunterhalts nach § 1610 BGB. Sie gilt bundesweit und wird vom Oberlandesgericht Düsseldorf jährlich aktualisiert.
Die Tabelle enthält u.a.:
- Bedarfssätze für minderjährige & volljährige Kinder
- Anrechnung des Kindergelds
- Selbstbehalte (Eigenbedarf)
- Einkommensgruppen bis über 11.000 €
- Regelungen zu Studierenden & Sonderbedarfen
Inhaltsverzeichnis
- Bedarfssätze 2025
- Kindergeld & Anrechnung 2025
- Selbstbehalte 2025
- Einkommensgruppen 2025
- Sonstige Regelungen
- Ausblick 2026
1. Bedarfssätze 2025
Neue Mindestunterhaltswerte ab 01.01.2025 gemäß Mindestunterhaltsverordnung:
- 1. Altersstufe (0–5 Jahre): 480 €
- 2. Altersstufe (6–11 Jahre): 551 €
- 3. Altersstufe (12–17 Jahre): 645 €
- Volljährige im Haushalt der Eltern: 628 €
Die Werte gelten für die 1. Einkommensgruppe bis 2.100 €. Mit jeder Einkommensstufe steigt der Bedarf entsprechend den Prozentsätzen der Tabelle.
Studierende mit eigenem Wohnsitz: Bedarfssatz 2025 unverändert 930 €.
2. Kindergeld & Anrechnung 2025
Kindergeld ab 01.01.2025 (unverändert):
- 1.–4. Kind: jeweils 250 €
Bei Minderjährigen wird das Kindergeld zur Hälfte angerechnet, bei Volljährigen voll.
Die konkreten Unterhaltszahlbeträge ergeben sich aus den offiziellen Zahlbetragstabellen.
3. Selbstbehalte 2025
Der notwendige Eigenbedarf (Selbstbehalt) gegenüber minderjährigen Kindern bleibt 2025:
- 1.450 € für Erwerbstätige
- 1.200 € für Nichterwerbstätige
inklusive Warmmiete von 520 € (kann im Einzelfall angepasst werden).
4. Einkommensgruppen 2025
Die Einkommensgruppen umfassen weiterhin Berechnungen bis über: 11.000 € bereinigtes Nettoeinkommen.
Ab 5.501 € folgen gestaffelte Mehrbedarfszonen bis 200 % des Mindestbedarfs.
5. Sonstige Regelungen
- Betreuungs- und Umgangsregelungen bleiben unberührt
- Erwerbstätigenbonus: 1/10 vom bereinigten Einkommen
- Sonderbedarf kann zusätzlich verlangt werden
6. Ausblick 2026
Aufgrund der erwarteten Lebenshaltungskostensteigerung und weiter steigenden Regelsätze ist auch 2026 mit einer erneuten Anhebung der Bedarfssätze zu rechnen.
Alle Tabellen, Zahlbeträge und Leitlinien finden Sie direkt beim:
Oberlandesgericht Düsseldorf – Düsseldorfer Tabelle
Hinweis: Die Düsseldorfer Tabelle ist eine Richtlinie – Abweichungen sind möglich, z. B. bei erhöhtem Bedarf (Musikschule, Internat, Behinderung).
Stand: 31.12.2025
Unterhaltsvorschuss - Wer hat Anspruch?
Bekommt ein alleinerziehender Elternteil vorübergehend oder auf Dauer keinen Unterhalt von seinem Expartner, erhält er vom Staat einen Unterhaltsvorschuss. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der sogenannten Düsseldorfer Tabelle, die die Leitlinien für den Unterhaltsbedarf von Unterhaltsberechtigten enthält.
Unterhaltsvorschuss 2024/2025: BVerwG bestätigt 40%-Grenze bei Mitbetreuung
Neues Grundsatzurteil: Anspruch entfällt ab 40 % Betreuungsanteil
Mit Urteil vom 12. Dezember 2023 hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) klargestellt: Ein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss besteht nur, wenn der Mitbetreuungsanteil des barunterhaltspflichtigen Elternteils unter 40 % liegt. Sobald die Mitbetreuung 40 % oder mehr erreicht, gilt das Kind nicht mehr als „allein vom betreuenden Elternteil versorgt“ – der Anspruch entfällt.
Was bedeutet das für getrennte Eltern?
- Unterhaltsvorschuss wird nur gezahlt, wenn das Kind überwiegend bei einem Elternteil lebt.
- „Überwiegend“ bedeutet konkret: mehr als 60 % Betreuung durch den antragstellenden Elternteil.
- Erbringt der andere Elternteil 40 % oder mehr Betreuungsleistung, entfällt der Anspruch.
Das Gericht sieht den Unterhaltsvorschuss als Unterstützung für alleinerziehende Eltern, deren Betreuungslast deutlich überwiegt. Eine gleichberechtigte oder nahezu gleichwertige Betreuung (Wechselmodell / Doppelresidenz) führt deshalb regelmäßig zum Ausschluss.
Bewertung der Betreuungszeit: ohne Wertung der Leistungen
Die Berechnung erfolgt ausschließlich anhand der tatsächlichen Betreuungszeiten – ohne Bewertung, ob ein Elternteil „mehr“ leistet (z. B. Hausaufgaben, Arzttermine, Fahrdienste).
- Ausgangspunkt ist die reale Aufenthaltszeit des Kindes.
- Typisierung: maßgeblich ist, wo das Kind sich zu Tagesbeginn aufhält.
- Gemeinsames Sorgerecht oder Bezug des Kindergeldes sind dafür nicht entscheidend.
Konsequenzen für das Wechselmodell
Bei nahezu hälftiger Betreuung (z. B. 50/50 oder 60/40) besteht in der Regel kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss.
Wichtig: Unerheblich ist, ob zusätzlich Barunterhalt gezahlt wird. Entscheidend ist allein der Betreuungsanteil.
Praxisbeispiel
Betreuung durch den Vater: 14-tägig Mittwoch bis Montag ≈ 36–40 %. Das BVerwG stellte fest, dass ab 40 % Mitbetreuung eine wesentliche Entlastung vorliegt → kein Unterhaltsvorschussanspruch.
Warum ist das Urteil so bedeutsam?
- klare bundesweite Schwelle (40 %-Grenze)
- Rechtsklarheit für Jugendämter, Familiengerichte und getrennte Eltern
- verbindliche Definition, wann „ Alleinerziehen“ vorliegt
Ergebnis
Der Anspruch auf Unterhaltsvorschuss besteht nur, wenn die Betreuung überwiegend bei einem Elternteil liegt. Wird der andere Elternteil zu mindestens 40 % in die Betreuung eingebunden, entfällt der Anspruch – auch wenn kein oder zu wenig Unterhalt gezahlt wird.
Damit stellt das BVerwG klar: Unterhaltsvorschuss ist keine Leistung für nahezu gleichbetreuende Eltern, sondern ausschließlich zur finanziellen Unterstützung alleinerziehender Haushalte.
Urteil: BVerwG, Beschluss vom 12.12.2023
Download Antrag auf Festsetung von Kindesunterhalt + Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
BGB – Unterhaltspflicht nach §§ 1601 ff. BGB (Familienrecht) – Überblick
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) · Buch 4 · Familienrecht · Verwandtschaft · Titel 3 Unterhalt · Untertitel 1 – Allgemeine Vorschriften
Die folgenden Vorschriften regeln die Unterhaltspflicht nach dem BGB – insbesondere Kindesunterhalt, Verwandtenunterhalt und die Anrechnung von Kindergeld. Hier finden Sie die wichtigsten Paragraphen des Unterhaltsrechts mit direkter Verlinkung zum Gesetzestext:
- § 1601 BGB – Unterhaltsverpflichtete (Wer muss Unterhalt zahlen?)
- § 1602 BGB – Bedürftigkeit (Wann besteht ein Unterhaltsanspruch?)
- § 1603 BGB – Leistungsfähigkeit (Wie viel Unterhalt ist zumutbar?)
- § 1604 BGB – Einfluss des Güterstands
- § 1605 BGB – Auskunftspflicht (Einkommens- und Vermögensauskunft)
- § 1606 BGB – Rangverhältnisse mehrerer Pflichtiger (z. B. beide Elternteile)
- § 1607 BGB – Ersatzhaftung und gesetzlicher Forderungsübergang
- § 1608 BGB – Haftung des Ehegatten oder Lebenspartners
- § 1609 BGB – Rangfolge mehrerer Unterhaltsberechtigter (z. B. Kinder, Ehegatte, Eltern)
- § 1610 BGB – Maß des Unterhalts (angemessener Unterhalt, Lebensstandard)
- § 1610a BGB – Deckungsvermutung bei schadensbedingten Mehraufwendungen
- § 1611 BGB – Beschränkung oder Wegfall der Unterhaltspflicht (z. B. grobe Undankbarkeit)
- § 1612 BGB – Art der Unterhaltsgewährung (Naturalunterhalt / Barunterhalt)
- § 1612a BGB – Mindestunterhalt minderjähriger Kinder; Verordnungsermächtigung
- § 1612b BGB – Deckung des Barbedarfs durch Kindergeld (Kindergeldanrechnung)
- § 1612c BGB – Anrechnung anderer kindbezogener Leistungen
- § 1613 BGB – Unterhalt für die Vergangenheit (Rückstände, Verzug)
- § 1614 BGB – Verzicht auf den Unterhaltsanspruch; Vorausleistung
- § 1615 BGB – Erlöschen des Unterhaltsanspruchs
Für eine konkrete Berechnung des Kindesunterhalts empfehlen wir zusätzlich einen Blick auf die Düsseldorfer Tabelle 2025 sowie unsere Praxishinweise zu Kindergeld, BAföG und Krankenversicherung.
Mit Unterhaltszahlungen Steuern sparen – Steuerliche Vorteile 2025
Unterhalt und Steuern einfach erklärt
Unterhaltszahlungen können zu erheblichen steuerlichen Entlastungen führen. Entscheidend ist, welche Art von Unterhalt gezahlt wird und welche Abzugsmethode gewählt wird: Sonderausgaben (Realsplitting) oder außergewöhnliche Belastungen.
Was zählt steuerlich zu Unterhaltsleistungen?
Unterhalt umfasst alle Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts ohne Gegenleistung:
- monatliche Geldzahlungen
- kostenfreie Überlassung von Wohnraum (Sachunterhalt)
- Übernahme laufender Kosten wie Heizung, Strom, Wasser
- Bezahlung von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen
Welche Unterhaltszahlungen sind steuerlich absetzbar?
Es gibt zwei steuerliche Abzugsmethoden:
-
Sonderausgabenabzug („Realsplitting“)
• steuerlich meist am vorteilhaftesten
• höchster Abzugsbetrag: bis zu 13.805 € jährlich (2025)
• zzgl. Beiträge zur Basis-Kranken- und Pflegeversicherung
• Zustimmung des Empfängers zwingend erforderlich (Anlage U) -
Außergewöhnliche Belastung
• möglich nur bei bedürftigen Angehörigen
• Höchstbetrag 2025: 10.908 € (§ 33a EStG)
• eigenes Einkommen des Empfängers wird angerechnet
Wichtig: Der Abzug erfolgt nur, wenn Unterhalt tatsächlich geleistet und nachgewiesen wird.
Voraussetzungen für den Steuerabzug
- kein Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag
- Bedürftigkeit der unterstützten Person
- Nachweis durch Überweisungen, Mietverträge, Zahlungsbelege
- Ausfüllen der Anlage U (bei Realsplitting)
Anhebung des Unterhaltshöchstbetrags nach § 33a EStG ab 2025/2026
Der Unterhaltshöchstbetrag gemäß § 33a Einkommensteuergesetz (EStG) wurde bereits stufenweise angepasst und soll künftig automatisch an den Grundfreibetrag gekoppelt werden. Damit steigt der steuerlich abzugsfähige Betrag regelmäßig – ohne erneuten Gesetzgebungsbedarf.
Aktueller Stand:
- 2022: 9.984 €
- 2023: 10.347 €
- 2024: 11.604 €
- 2025 (voraussichtlich): Anpassung entsprechend Grundfreibetrag auf ca. 11.784 €
- 2026 (Prognose): weitere Anpassung über den dynamischen Grundfreibetrag
Damit können Sie Unterhaltsleistungen, Ausbildungsbedarf und Lebenshaltungskosten für unterhaltsberechtigte Personen in deutlich größerem Umfang steuerlich geltend machen.
Wichtig für die Steuererklärung:
- Abzugsfähig sind Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen ohne Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag.
- Eigenes Einkommen der unterstützten Person wird auf den Höchstbetrag angerechnet.
- Beiträge zur Basis-Kranken- und Pflegeversicherung erhöhen den abzugsfähigen Betrag zusätzlich.
- Nachweise müssen durch Überweisungsbelege, Unterhaltsvereinbarungen oder Bescheide erbracht werden.
Durch die geplante Kopplung an den Grundfreibetrag erfolgt die jährliche Anpassung künftig automatisch und dynamisch. Das sorgt für mehr Transparenz, Planbarkeit und eine spürbare steuerliche Entlastung für Unterhaltsleistende – insbesondere bei längeren Ausbildungszeiten von Kindern.
Was ist nicht steuerlich absetzbar?
- Vermögensausgleich nach Scheidung (z. B. Pkw-Übertragung, Immobilienübertragung)
- Gerichts- und Anwaltskosten zur Zustimmung des Realsplittings
- Unterhalt für Kinder mit Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag
Zustimmungspflicht beim Realsplitting
Der Unterhaltsempfänger muss der steuerlichen Geltendmachung zustimmen. Die Zustimmung erfolgt über die Anlage U und muss unterschrieben werden.
Hinweis: Für den Empfänger kann eine Steuerpflicht entstehen. Gegebenenfalls sollte ein Ausgleich vereinbart werden.
Unterhalt für Kinder: Steuerliche Besonderheiten
Kindesunterhalt ist nicht steuerlich abzugsfähig, wenn ein Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag besteht.
Damit ist die steuerliche Abgeltung bereits erfolgt.
Steuerliche Besonderheiten bei Zuschüssen & Stipendien
Stipendien mindern den Unterhaltsbedarf nur zeitanteilig (§ 33a Abs. 3 EStG).
Erst eigene Einkünfte des Kindes anrechnen, dann Zuschüsse.
Steuer-Tipp
Prüfen Sie, ob der Sonderausgabenabzug steuerlich günstiger ist. In der Regel ergibt sich dadurch die höchste Steuerersparnis, insbesondere bei hohen Unterhaltszahlungen inklusive Krankenversicherung.
Ergebnis
Unterhaltsleistungen können Steuern sparen – jedoch nur bei korrekter Wahl des Abzugsmodells. Der Sonderausgabenabzug (Realsplitting) bringt in den meisten Fällen die größte steuerliche Entlastung, erfordert jedoch die Zustimmung der unterhaltenen Person.
Empfehlung: Lassen Sie sich vorab steuerlich beraten, um Nachteile beim Empfänger und Nachzahlungen zu vermeiden.
FAQ Unterhalt – Kindesunterhalt, Ehegattenunterhalt & Steuern
FAQ Unterhalt: Häufige Fragen zu Kindesunterhalt, Ehegattenunterhalt, Düsseldorfer Tabelle, Unterhaltsvorschuss und steuerlicher Absetzbarkeit von Unterhaltsleistungen.
FAQ Unterhalt
Kindesunterhalt, Düsseldorfer Tabelle, Unterhaltsvorschuss, BAföG & Steuerfragen einfach erklärt.
Wie wird der Kindesunterhalt berechnet?
Die Höhe richtet sich nach:
- unterhaltsrelevantem Einkommen
- Altersstufe des Kindes
- Düsseldorfer Tabelle (Bedarfssatz)
- Anrechnung des Kindergelds
Volljährige: Kindergeld wird vollständig angerechnet.
Wann besteht Anspruch auf Unterhaltsvorschuss?
Unterhaltsvorschuss erhält ein Kind, wenn der barunterhaltspflichtige Elternteil keinen/zu wenig Unterhalt zahlt und das Kind überwiegend bei einem Elternteil lebt.
Seit dem Urteil vom 12.12.2023 gilt: Bei 40 % oder mehr Mitbetreuung des anderen Elternteils besteht kein Anspruch.
Können Unterhaltszahlungen steuerlich abgesetzt werden?
Zwei Wege:
- Sonderausgaben (Realsplitting): Zustimmung Empfänger zwingend (Anlage U)
- Außergewöhnliche Belastung (§33a EStG): wenn Bedürftigkeit vorliegt
Eigene Einkünfte der unterstützten Person mindern den abziehbaren Betrag.
Was ist die Düsseldorfer Tabelle?
Sie ist die bundesweite Richtlinie zur Bestimmung des Kindesunterhalts. Kein Gesetz, aber Standard im Familienrecht.
Berücksichtigt:
- Nettoeinkommen
- Altersgruppe
- Bedarfssätze
Aktuelles + weitere Infos
Weitere Infos im Steuerlexikon:
- Unterhaltsleistungen
- Unterhaltsleistungen - Ausland
- Unterhaltsleistungen - Erhöhungsbetrag
- Unterhaltsleistungen - Wehrdienstkinder
Alle Tabellen & Zahlbeträge: Düsseldorfer Tabelle – Offizielle Übersicht beim OLG Düsseldorf
Weitere Infos zur Düsseldorfer Tabelle ...
Weitere Rechner:
Noch mehr hilfreiche Steuerrechner
Rechtsgrundlagen zum Thema: Unterhalt
EStGEStG § 3
EStG § 4 Gewinnbegriff im Allgemeinen
EStG § 10
EStG § 12
EStG § 19
EStG § 22 Arten der sonstigen Einkünfte
EStG § 32 Kinder, Freibeträge für Kinder
EStG § 32b Progressionsvorbehalt
EStG § 33a Außergewöhnliche Belastung in besonderen Fällen
EStG § 49 Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte
EStG § 50 Sondervorschriften für beschränkt Steuerpflichtige
EStG § 50a Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen
EStG § 52 Anwendungsvorschriften
EStG § 64 Zusammentreffen mehrerer Ansprüche
EStG § 74 Zahlung des Kindergeldes in Sonderfällen
EStG § 75 Aufrechnung
EStG § 76 Pfändung
EStR
EStR R 4.10 Geschenke, Bewirtung, andere die Lebensführung berührende Betriebsausgaben
EStR R 10.2 Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten
EStR R 10.3 Versorgungsleistungen
EStR R 10.4 Vorsorgeaufwendungen (Allgemeines)
EStR R 10.9 Aufwendungen für die Berufsausbildung
EStR R 10.10 Schulgeld
EStR R 31. Familienleistungsausgleich
EStR R 32.13 Übertragung der Freibeträge für Kinder
EStR R 32b. Progressionsvorbehalt
EStR R 33a.1 Aufwendungen für den Unterhalt und eine etwaige Berufsausbildung
EStR R 33a.3 Zeitanteilige Ermäßigung nach § 33a Abs. 3 EStG
EStR R 44b.2 Einzelantrag beim BZSt (§ 44b EStG)
EStR R 49.1 Beschränkte Steuerpflicht bei Einkünften aus Gewerbebetrieb
GewStG
GewStG § 2 Steuergegenstand
GewStG § 3 Befreiungen
GewStG § 4 Hebeberechtigte Gemeinde
GewStG § 28 Allgemeines
KStG 3 5 8
UStG
UStG § 3a Ort der sonstigen Leistung
AO
AO § 18 Gesonderte Feststellungen
AO § 53 Mildtätige Zwecke
AO § 54 Kirchliche Zwecke
AO § 58 Steuerlich unschädliche Betätigungen
AO § 64 Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
AO § 68 Einzelne Zweckbetriebe
AO § 193 Zulässigkeit einer Außenprüfung
AO Anlage 1 (zu § 60)
AO § 18 Gesonderte Feststellungen
AO § 53 Mildtätige Zwecke
AO § 54 Kirchliche Zwecke
AO § 58 Steuerlich unschädliche Betätigungen
AO § 64 Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe
AO § 68 Einzelne Zweckbetriebe
AO § 193 Zulässigkeit einer Außenprüfung
AO Anlage 1 (zu § 60)
UStAE
UStAE 1.1. Leistungsaustausch
UStAE 1.5. Geschäftsveräußerung im Ganzen
UStAE 1.6. Leistungsaustausch bei Gesellschaftsverhältnissen
UStAE 1.9. Inland – Ausland
UStAE 2.3. Gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
UStAE 2.9. Beschränkung der Organschaft auf das Inland
UStAE 2.10. Unternehmereigenschaft und Vorsteuerabzug bei Vereinen, Forschungsbetrieben und ähnlichen Einrichtungen
UStAE 3.7. Vermittlung oder Eigenhandel
UStAE 3a.2. Ort der sonstigen Leistung bei Leistungen an Unternehmer und diesen gleichgestellte juristische Personen
UStAE 3a.3. Ort der sonstigen Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück
UStAE 3a.6. Ort der Tätigkeit
UStAE 3a.11. Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen
UStAE 3a.12. Auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen
UStAE 4.8.1. Vermittlungsleistungen im Sinne des § 4 Nr. 8 und 11 UStG
UStAE 4.8.9. Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren
UStAE 4.8.13. Verwaltung von Investmentfonds und von Versorgungseinrichtungen
UStAE 4.12.11. Nutzungsüberlassung von Sportanlagen und anderen Anlagen
UStAE 4.20.1. Theater
UStAE 4.20.2. Orchester, Kammermusikensembles und Chöre
UStAE 4.23.1. Beherbergung und Beköstigung von Jugendlichen
UStAE 4.24.1. Jugendherbergswesen
UStAE 10.2. Zuschüsse
UStAE 12.5. Eintrittsberechtigung für Theater, Konzerte, Museen usw.
UStAE 12.7. Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung urheberrechtlicher Schutzrechte
UStAE 12.8. Zirkusunternehmen, Schausteller und zoologische Gärten
UStAE 12.9. Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Einrichtungen
UStAE 12.11. Schwimm- und Heilbäder, Bereitstellung von Kureinrichtungen
UStAE 14.2. Rechnungserteilungspflicht bei Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück
UStAE 15.6. Vorsteuerabzug bei Repräsentationsaufwendungen
UStAE 15.12. Allgemeines zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug
UStAE 15.17. Aufteilung der Vorsteuerbeträge nach § 15 Abs. 4 UStG
UStAE 15.23. Vorsteuerabzug und Umsatzbesteuerung bei (teil-)unternehmerisch verwendeten Fahrzeugen
UStAE 15a.6. Berichtigung nach § 15a Abs. 3 UStG
UStAE 1.1. Leistungsaustausch
UStAE 1.5. Geschäftsveräußerung im Ganzen
UStAE 1.6. Leistungsaustausch bei Gesellschaftsverhältnissen
UStAE 1.9. Inland – Ausland
UStAE 2.3. Gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
UStAE 2.9. Beschränkung der Organschaft auf das Inland
UStAE 2.10. Unternehmereigenschaft und Vorsteuerabzug bei Vereinen, Forschungsbetrieben und ähnlichen Einrichtungen
UStAE 3.7. Vermittlung oder Eigenhandel
UStAE 3a.2. Ort der sonstigen Leistung bei Leistungen an Unternehmer und diesen gleichgestellte juristische Personen
UStAE 3a.3. Ort der sonstigen Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück
UStAE 3a.6. Ort der Tätigkeit
UStAE 3a.11. Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen
UStAE 3a.12. Auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen
UStAE 4.8.1. Vermittlungsleistungen im Sinne des § 4 Nr. 8 und 11 UStG
UStAE 4.8.9. Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren
UStAE 4.8.13. Verwaltung von Investmentfonds und von Versorgungseinrichtungen
UStAE 4.12.11. Nutzungsüberlassung von Sportanlagen und anderen Anlagen
UStAE 4.20.1. Theater
UStAE 4.20.2. Orchester, Kammermusikensembles und Chöre
UStAE 4.23.1. Beherbergung und Beköstigung von Jugendlichen
UStAE 4.24.1. Jugendherbergswesen
UStAE 10.2. Zuschüsse
UStAE 12.5. Eintrittsberechtigung für Theater, Konzerte, Museen usw.
UStAE 12.7. Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung urheberrechtlicher Schutzrechte
UStAE 12.8. Zirkusunternehmen, Schausteller und zoologische Gärten
UStAE 12.9. Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Einrichtungen
UStAE 12.11. Schwimm- und Heilbäder, Bereitstellung von Kureinrichtungen
UStAE 14.2. Rechnungserteilungspflicht bei Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück
UStAE 15.6. Vorsteuerabzug bei Repräsentationsaufwendungen
UStAE 15.12. Allgemeines zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug
UStAE 15.17. Aufteilung der Vorsteuerbeträge nach § 15 Abs. 4 UStG
UStAE 15.23. Vorsteuerabzug und Umsatzbesteuerung bei (teil-)unternehmerisch verwendeten Fahrzeugen
UStAE 15a.6. Berichtigung nach § 15a Abs. 3 UStG
GewStR
GewStR R 1.3 Örtliche Zuständigkeit für die Festsetzung und Zerlegung des Steuermessbetrags
GewStR R 2.1 Gewerbebetrieb
GewStR R 2.4 Mehrheit von Betrieben
GewStR R 2.9 Betriebsstätte
GewStR R 7.1 Gewerbeertrag
GewStR R 35a.1 Reisegewerbebetriebe
UStR
UStR 1. Leistungsaustausch
UStR 5. Geschäftsveräußerung
UStR 6. Leistungsaustausch bei Gesellschaftsverhältnissen
UStR 13. Inland – Ausland
UStR 18. Gewerbliche oder berufliche Tätigkeit
UStR 21a. Beschränkung der Organschaft auf das Inland
UStR 22. Unternehmereigenschaft und Vorsteuerabzug bei Vereinen, Forschungsbetrieben und ähnlichen Einrichtungen
UStR 26. Vermittlung oder Eigenhandel
UStR 34. Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück
UStR 36. Ort der Tätigkeit
UStR 39b. Rundfunk- und Fernsehdienstleistungen im Sinne des § 3a Abs. 4 Nr. 13 UStG
UStR 39c. Auf elektronischem Weg erbrachte sonstige Leistungen im Sinne des § 3a Abs. 4 Nr. 14 UStG
UStR 65. Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren
UStR 86. Nutzungsüberlassung von Sportanlagen und anderen Anlagen
UStR 99. Altenheime, Altenwohnheime und Pflegeheime
UStR 106. Theater
UStR 107. Orchester, Kammermusikensembles und Chöre
UStR 117. Beherbergung und Beköstigung von Jugendlichen
UStR 118. Jugendherbergswesen
UStR 150. Zuschüsse
UStR 166. Eintrittsberechtigung für Theater, Konzerte, Museen usw.
UStR 168. Einräumung, Übertragung und Wahrnehmung urheberrechtlicher Schutzrechte
UStR 169. Zirkusunternehmen, Schausteller und zoologische Gärten
UStR 170. Gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Einrichtungen
UStR 171. Schwimm- und Heilbäder, Bereitstellung von Kureinrichtungen
UStR 183a. Rechnungserteilungspflicht bei Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück
UStR 192. Abzug der gesondert in Rechnung gestellten Steuerbeträge als Vorsteuer
UStR 203. Allgemeines zum Ausschluss vom Vorsteuerabzug
UStR 208. Aufteilung der Vorsteuerbeträge nach § 15 Abs. 4 UStG
UStR 217b. Berichtigung nach § 15a Abs. 3 UStG
KStR 5.7 5.13 8.2
GewStDV 5 6 8 25
AEAO
AEAO Zu § 15 Angehörige:
AEAO Zu § 30 Steuergeheimnis:
AEAO Zu § 31a Mitteilungen zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung und des Leistungsmissbrauchs:
AEAO Zu § 52 Gemeinnützige Zwecke:
AEAO Zu § 53 Mildtätige Zwecke:
AEAO Zu § 55 Selbstlosigkeit:
AEAO Zu § 56 Ausschließlichkeit:
AEAO Zu § 58 Steuerlich unschädliche Betätigungen:
AEAO Zu § 59 Voraussetzung der Steuervergünstigung:
AEAO Zu § 64 Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe:
AEAO Zu § 67a Sportliche Veranstaltungen:
AEAO Zu § 68 Einzelne Zweckbetriebe:
AEAO Zu § 75 Haftung des Betriebsübernehmers:
AEAO Zu § 111 Amtshilfepflicht:
AEAO Zu § 122 Bekanntgabe des Verwaltungsakts:
AEAO Zu § 141 Buchführungspflicht bestimmter Steuerpflichtiger:
AEAO Zu § 175 Änderung von Steuerbescheiden auf Grund von Grundlagenbescheiden und bei rückwirkenden Ereignissen:
AEAO Zu § 197 Bekanntgabe der Prüfungsanordnung:
AEAO Zu § 251 Insolvenzverfahren:
HGB
§ 62 HGB Pflichten des Arbeitgebers; Fürsorgepflicht
§ 564 HGB Kosten für den Betrieb des Schiffes
ErbStG 13
ErbStR 2.2 7.4 10.6 13.5 13b.13
LStR
R 3.6 LStR Gesetzliche Bezüge der Wehr- und Zivildienstbeschädigten, Kriegsbeschädigten, ihrer Hinterbliebenen und der ihnen gleichgestellten Personen
R 9.11 LStR Mehraufwendungen bei doppelter Haushaltsführung
R 19.8 LStR Zu den nach § 19 Abs. 2 EStG steuerbegünstigten Versorgungsbezügen gehören auch:
R 39.4 LStR Lohnsteuerabzug bei beschränkter Einkommensteuerpflicht
BewG 121 152
EStH 3.7 3.44 4.2.2 4.8 4.10.1 4.10.12 10.2 12.6 15.5 15.6 15.9.2 15.10 16.1 21.4 22.1 31 32.9 32.13 32b 33.1.33.4 33a.1 33a.3 33b 50a.2
StbVV
§ 18 StBVV Geschäftsreisen
GewStH 2.1.4 2.1.5 2.8 2.9.1 2.9.3 7.1.1
KStH 4.5 8.2
LStH 3.6 3.11 3.12 9.1
ErbStH E.7.1 E.7.2 B.183.4
AStG 8
GrStG
§ 4 GrStG Sonstige Steuerbefreiungen
§ 5 GrStG Zu Wohnzwecken benutzter Grundbesitz
GrStR 12 14 18 21 22 25 26 38
StBerG
§ 4 StBerG Befugnis zu beschränkter Hilfeleistung in Steuersachen
§ 23 StBerG Ausübung der Hilfeleistung in Steuersachen im Rahmen der Befugnis nach § 4 Nr. 11, Beratungsstellen
§ 34 StBerG Berufliche Niederlassung, weitere Beratungsstellen
§ 44 StBerG Bezeichnung „Landwirtschaftliche Buchstelle“
§ 67 StBerG Berufshaftpflichtversicherung
BGB 204 519 528 529 618 679 685 761 829 833 836 838 843 844 922 1021 1022 1041 1318 1360 1360a 1360b 1361 1420 1447 1469 1495 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1578a 1578b 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1585a 1585b 1585c 1586 1586a 1586b 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1610a 1611 1612 1612a 1612b 1612c 1613 1614 1615 1615a 1615b bis 1615k 1615l 1615m 1615n 1619 1629 1640 1649 1666 1688 1712 1751 1755 1770 1835a 1836c 1836d 1933 1963 1969 2141 2295 2333
 Steuer-Newsletter
Steuer-Newsletter